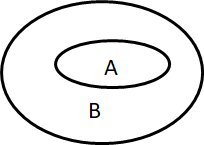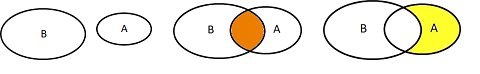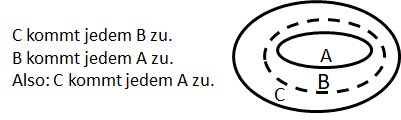Dem naiven – nein: dem kindlichen Gemüt erscheint alles, was vorkommt, 'so, wie es ist'; d. h. als wenn es ist. Dabei unterscheidet es nicht zwischen 'außen' und 'innen': Alles 'kommt vor' mit gleicher Gewissheit.
Aber nur im ersten Moment. Denn sogleich zeigt sich ein Unterschied zwischen einem, das bleibt, und einem, das wechselt. Das Bemerken eines Unterschieds zwischen Bleibendem und Wechselndem ist der erste Akt der Reflexion: Denn es bedarf des Erinnerns – an das, was bleibt, und an das Wechselnde. Das Gemüt achtet auf 'sich selbst'. Indes, auch diese Unterscheidung 'kommt' ihm 'vor'. Seine Erinnerung gehört zum Vorkommenden und ist nicht ich, sondern ein Es wie Alle Andern.
Sobald das Gemüt das Gedächtnis als sein eigenes wahrnimmt, hat es Sinn, von Bewusstsein zu reden. Ist es richtig, diese Einsicht in die Eigenheit des Erinnerns aus dem Verkehr mit den Andern her zu leiten? Das setzte voraus, dass die vorkommenden Andern als 'in gewisser Hinsicht mir gleich' erkannt und von dem toten Andern unter- schieden wurden. Eine Unterscheidung, die schlechterdings nicht anders als aus dem Verkehr her zu leiten ist! Eine Unterscheidung, die allerdings nicht Menschen und Dinge 'setzt', sondern Belebtes, d. h. Handelndes, und totes Vorkommnis.
Wobei unklar ist, wo die Grenze verläuft: 'Handelt' das Wetter, handeln Sonne und Mond? Die Tiere handeln auf jeden Fall. Die erste Stufe des Bewusstseins kann nicht anders als animistisch sein. 'Das Animierte' wird sodann nur geordnet nach dem, was mir im Verkehr 'näher', und was mir 'ferner' steht. Die fremde Menschen- gruppe mag, je nach Grad der Feindseligkeit, mal als den Tieren und mal als 'uns selbst' näher wahrgenommen werden.
aus e. Notizbuch, um 2006
Nachtrag. Der Grundgedanke, dass das Bewusstsein aus dem Gedächtnis stammt, ist von Fritz Mauthner; ich habe es nicht hinzugefügt, weil ich es wohl noch nicht wusste (obwohl ich es womöglich auf Umwegen doch von ihm hatte).
Das ist nicht Transzendentalphilosophie, sondern Denkpsychologie. Psychologie tout court ist, dass die Vorstel- lung, die sich die empirische Person von 'ihrem Ich' macht, aus dem besteht, woran sie sich erinnert - und daran, wie sie es heute wertet. Wie sie es wertet, beruht darauf, was sie meint gesollt zu haben.
Auch da kämen Erinnerungen drin vor? Ja, aber die sind, und sei es nachträglich, immer schon gemessen an einer 'Idee', die ich mir selbst gemacht habe. Und wie viel empirisch Erinnertes wiederum auch darin eingegangen sein mögen - um es selber zu bewerten (was der Psychologe ja nicht tut), müsste ein Anderer auf seine Idee zurück- greifen; seine Idee von dem, was man soll.
Kurz und gut - der moralische Anteil am Bewusstsein stammt nicht aus dem, woran ich mich erinnere, sondern aus dem, woran ich mich erinnere.
Das hast du getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Und nach einer Weile gibt mein Ge- dächtnis nach.
Nietzsche





 powered by plista
powered by plista