I. „Was ist Wahrheit?“ (Joh. 18,38)
Was ist Wahrheit, fragt Pontius Pilatus, und will sagen: Es ist ja alles relativ… Klang es bei ihm philosophisch-resigniert, so machte die Postmoderne, die wir in diesen Tagen hinter unslassen, eine
 Tugend aus der Not: “Anything goes…”, krähte sie selbstgefällig-vergnügt: “…Hauptsache, es funktioniert!”
Tugend aus der Not: “Anything goes…”, krähte sie selbstgefällig-vergnügt: “…Hauptsache, es funktioniert!” Darin sind sich Analytische Philosophie, Konstruktivismus und Dekonstruktivismus, die seit Jahr und Tag konkurrierend das geistige Feld beherrschen, einig: Die Frage nach der Wahrheit ist “metaphysisch”, was so viel bedeutet wie: unstatthaft; denn sie sei so gefasst, dass darauf immer nur eine dogmatische Antwort möglich sei, nämlich eine, die aus Glaubenssätzen stammt und nicht aus vernünftigem Argument.
Am Anfang der Moderne – die die Postmoderne doch zu überbieten trachtete – stand, wie gesagt, die Romantik. Was das Wahre sei, war den Romantikern so ungewiss geworden, dass sie gelegentlich zu der Auffassung neigten, das Ungewisse sei selber das Wahre. Der Rationalismus und die “Aufklärung” des 17. und 18. Jahrhunderts hatte an die Stelle der geoffenbarten Wahrheiten der voraus gegangenen Dunklen Jahrhunderte die stolze Selbstgewissheit der Vernunft gesetzt. Aber die war durch Immanuel Kants Drei Kritiken gehörig ins Wanken geraten. Die Romantik war in Jena aus der unmittelbaren Anregung durch die ‘Wissenschafsftlehre’ Johann Gottlieb Fichtes entstanden. Der verstand sich als der Radikalisierer und Vollender von Kants kritischer bzw. ‘Transzendental’-Philosophie.
Zu der Zeit tummelten sich auf den öffentlichen Plätzen – wie heut im Zeichen der Postmoderne – jene, die meinten, die Wahrheit gebe es gar nicht, allenfalls Wahrheiten…, und sich dabei furchtbar schlau vorkamen. Aber das ist nur eine Ausflucht. Wenn diese ‘vereinzelten’ Wahrheiten wahr sein sollen, dann sind die es unbedingt. Wenn sie nur bedingt wahr sind, dann ist dasjenige, was sie bedingt, unbedingt wahr – oder Alles ist nicht wahr.
Um die Frage, was das Wahre ist, kommen wir also nicht herum. Und halten wir gleiche eines fest, um das wir auch nicht herum kommen: dass das Wahre zunächst einmal als Frage “ist”.
*
Wahrheit ist keine Sache, sondern ein Verhältnis. Nämlich zwischen einem, der etwas weiß, und demjenigen, was er weiß. Das Wort sagt etwas über die Qualität dieses Verhältnisses aus: nicht, dass es ‘ist’, sondern dass es gilt. Etwas ‘gilt’ freilich nur für irgendwen. Und auch nicht an und für sich, sondern erst wenn und insofern er etwas tun will oder soll. Es mag auch nur ein rein gedankliches Tun sein: vorstellen und über Vorstellungen urteilen.
Ob etwas ‘gültig’ und also “wahr” ist, wird sich erweisen im und durch den Vollzug dieser Handlung. Wenn also etwa das betroffene Urteil ‘richtig’ ist, und das heißt: zu weitergehendem Urteilen taugt. Hier passt ein ‘Fragment’ des Urromantikers Friedrich Schlegel: “Logik ist eine praktische Wissenschaft.”
Bis hierhin ist das eine rein pragmatische Bestimmung: Wahrheit erweist sich jeweils vor ihren Zwecken, sie ist eine Zweckmäßigkeit. Wahrheit ist nicht Etwas, das “ist”, sondern das, was sein soll. Das ist aber erst der Anfang. Richtig ernst wird es erst wenn nach den Zwecken selbst gefragt wird: wozu ‘Wahrheit’ taugen soll. “Gibt es” einen absoluten Zweck?
Darüber will ich
gerne weiter diskutieren. Aber in einem Beitrag ist es natürlich nicht
abzumachen. Es wird eine ganze Reihe nötig werden… Und mehr als einmal
werden der Autor und seine Leser im Lauf der Auseinandersetzung das
ungute Gefühl haben: Aber an der Stelle waren wir doch schon mal! Drehn
wir uns im Kreis?
Ja, wir sind wieder am selben Punkt; aber diesmal ein paar Etage höher: Es ist wie eine Wendeltreppe.
 |
II. Philosophie ist kritisch
Früher
hieß es, Philosophie sei eine spezifisch abendländische Errungenschaft.
Dann wurde gesagt, es gäbe auch eine indische, eine chinesische und
sogar eine afrikanische und indianische Philosophie.
Weisheitslehren, die verkünden, was wahr ist, hat es immer und überall gegeben. Aber die Frage, was Wahrheit ist, ist allerdings im Abendland aufgebracht und ausgeführt worden. Sie setzt nämlich voraus, dass Wahrheit etwas ist, wonach ich fragen und was ich beurteilen kann – so wie jeder andere, der ebenfalls ich sagen kann. Setzt also voraus, dass ich mir die Fähigkeit zu eigenem Urteil zumesse; und mich nicht auf etwas verlassen darf, was mir von höherer Instanz “offenbart” worden ist. Und es setzt voraus, dass “es” Gründe “gibt”, auf die ich mich bei meinem Urteil stützen kann. – Beides mag man in Abrede stellen. Nur kann man sich dann an einer vernünftigen (!) Erörterung dieser Dinge nicht mehr beteiligen.
Weisheitslehren, die verkünden, was wahr ist, hat es immer und überall gegeben. Aber die Frage, was Wahrheit ist, ist allerdings im Abendland aufgebracht und ausgeführt worden. Sie setzt nämlich voraus, dass Wahrheit etwas ist, wonach ich fragen und was ich beurteilen kann – so wie jeder andere, der ebenfalls ich sagen kann. Setzt also voraus, dass ich mir die Fähigkeit zu eigenem Urteil zumesse; und mich nicht auf etwas verlassen darf, was mir von höherer Instanz “offenbart” worden ist. Und es setzt voraus, dass “es” Gründe “gibt”, auf die ich mich bei meinem Urteil stützen kann. – Beides mag man in Abrede stellen. Nur kann man sich dann an einer vernünftigen (!) Erörterung dieser Dinge nicht mehr beteiligen.
Philo-Sophie hat ihren Namen daher, dass der “Sokrates”, wie er in Platos Dialogen auftritt, sich selber keinen sophos, keinen Weisen nennen wollte, sondern lediglich einen philo-sophos, einen Freund der Weisheit, der die Wahrheit sucht, weil er sie nicht hat.
Begonnen hat das mit Thales aus Milet in Kleinasien (650-560 v.Chr.). Der verkündete zwar auch nur, ‘was wahr ist’. Aber er unterschied bereits zwischen dem, was zu sein ’scheint’, und dem, was ‘wirklich’ ist. In Wirklichkeit sei nämlich alles Wasser. Dieser ‘Urstoff’ wurde von seinen Nachfolgern mal als apeirón, als das Grenzenlose bestimmt (Anaximander, 610-546 v.Chr), mal als noûs, als Weltvernunft (Anaxagoras, 500-428 v.Chr.).
Der entscheidende ‘Sprung’ trat ein mit Heraklit aus Ephesos (ebenfalls Kleinasien; 550-480 v.Chr.). Er meinte nicht nur, die Erscheinung von Werden und Vergehen sei das einzig Wirkliche (”Alles fließt” wird ihm zugeschrieben), hinter dem es kein Bleibendes gibt. Er wägt auch erstmals Argumente gegeneinander ab und urteilt, warum dieses gilt und jenes nicht. In einem strengen Sinn ist er der Vater der Philosophie.
Widersprochen haben ihm sogleich die Eleaten, die Anhänger einer Philosophenschule in Elea in Süditalien, allen voran Parmenides (540-470 v.Chr.). Ihnen zufolge ist im Gegenteil alles Werden und Vergehen bloßer Schein, das einzig Wahre ist das Sein selbst, ontos on. Auch sie argumentieren mit Gründen, und anscheinend ebenso plausibel wie Heraklit.
Plato aus Athen (427-347 v.Chr.) versucht, die widerstreitenden Argumente beider Parteien systematisch gegeneinander zu gewichten und “dialektisch” aufzuheben (wobei er seine Gedanken seinem Lehrer Sokrates in den Mund legt). Ausschlaggebend sind immer und lediglich Vernunftgründe, die einem Jeden zugänglich sind, der willens ist. Höhere Eingebungen gelten ihm nichts. Seither ist Kritik – von gr. krínein=urteilen – das Medium der Philosophie; nämlich derjenigen, die diesen Namen verdient: der abendländischen.
III. Wie die Wissenschaft entstand.
Das
bisherige Ergebnis war: Philosophie ist ihrem Wesen nach kritisch.
Kritisch sein heißt: nichts gelten lassen, als was auf seine Gründe hin
überprüft ist. So wurde die Philosophie zum Inbegriff und Modell der
abendländischen Wissenschaften. Denn nicht jede mehr oder weniger wohl
geordnete Ansammlung von Gewusstem ist schon Wissenschaft. Wissenschaft
ist ein System von Aussagen, die untereinander in einem
Begründungsverhältnis stehen. Alles andere ist nicht Wissen, sondern
Dogma: Glaubenssatz.
Die Frage nach dem hinreichenden Grund lässt sich indessen ins Bodenlose hinab weiter treiben. Wenn nämlich stattdessen eine allererster (oder allerletzter) doch einmal gefunden würde, so könnte er der Definition nach nicht “begründet” sein – und dürfte nicht gelten. Wenn aber das Wissen allerdings auf einem Regressus in infinitum “beruht”, ist es ebenfalls nicht begründet!
Die Philosophie ist nun diejenige Wissenschaft, die sich diesem Paradox stellt – auf die Gefahr hin, es am Ende niemals (theoretisch) zu “lösen”, sondern höchstens (praktisch) in einem Akt überspringen zu können. Reelle Wissenschaft kann indessen nicht warten, bis das Problem der Letztbegründung zu Aller Zufriedenheit erledigt ist. Sie hat auch nicht gewartet, jedenfalls nicht mehr, als mit den
Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch
verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen
Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.
mehr, als mit den
Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch
verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen
Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.
Aber sie hatte ihre Vorgeschichte. Positives Wissen ist angesammelt worden, seit Homo sapiens die Erdoberfläche durchstreift. Mehr oder weniger zufälliges Erfahrungswissen wurde von Mund zu Mund von einer Generation auf die andre vererbt, und je spezifischer es war, umso exklusiver wurde es überliefert. Ärzte, Baumeister, Handwerker jeglichen Fachs, Seeleute, Landwirte: Alle hatten ihre Geheimnisse, die nur an Eingeweihte weiter gereicht wurden. Gelegentlich aufge- schriebene Kompendien hatte einen “aporetischen” Charakter (von gr. áporos=ohne Weg), d. h. sie waren um jeweils einzelne Probleme gruppiert, ohne nach durchgängigen Begründungszusammenhängen zu suchen.
Die “metaphysischen” (=jenseits der Physik angesiedelten) Spekulationen der Schulphilosophie brachten ihrerseits kein positives Wissen zustande, und hatten auch gar nicht diesen Ehrgeiz. Sie wollten “Betrachtung” (gr. theoría) sein und keine prâxis. Dennoch ist Wissenschaft im strengen Sinn durch die Philosophie zu Stande gekommen! Nämlich als Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”.
Die Frage nach dem hinreichenden Grund lässt sich indessen ins Bodenlose hinab weiter treiben. Wenn nämlich stattdessen eine allererster (oder allerletzter) doch einmal gefunden würde, so könnte er der Definition nach nicht “begründet” sein – und dürfte nicht gelten. Wenn aber das Wissen allerdings auf einem Regressus in infinitum “beruht”, ist es ebenfalls nicht begründet!
Die Philosophie ist nun diejenige Wissenschaft, die sich diesem Paradox stellt – auf die Gefahr hin, es am Ende niemals (theoretisch) zu “lösen”, sondern höchstens (praktisch) in einem Akt überspringen zu können. Reelle Wissenschaft kann indessen nicht warten, bis das Problem der Letztbegründung zu Aller Zufriedenheit erledigt ist. Sie hat auch nicht gewartet, jedenfalls nicht
 mehr, als mit den
Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch
verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen
Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.
mehr, als mit den
Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch
verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen
Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden. Aber sie hatte ihre Vorgeschichte. Positives Wissen ist angesammelt worden, seit Homo sapiens die Erdoberfläche durchstreift. Mehr oder weniger zufälliges Erfahrungswissen wurde von Mund zu Mund von einer Generation auf die andre vererbt, und je spezifischer es war, umso exklusiver wurde es überliefert. Ärzte, Baumeister, Handwerker jeglichen Fachs, Seeleute, Landwirte: Alle hatten ihre Geheimnisse, die nur an Eingeweihte weiter gereicht wurden. Gelegentlich aufge- schriebene Kompendien hatte einen “aporetischen” Charakter (von gr. áporos=ohne Weg), d. h. sie waren um jeweils einzelne Probleme gruppiert, ohne nach durchgängigen Begründungszusammenhängen zu suchen.
Die “metaphysischen” (=jenseits der Physik angesiedelten) Spekulationen der Schulphilosophie brachten ihrerseits kein positives Wissen zustande, und hatten auch gar nicht diesen Ehrgeiz. Sie wollten “Betrachtung” (gr. theoría) sein und keine prâxis. Dennoch ist Wissenschaft im strengen Sinn durch die Philosophie zu Stande gekommen! Nämlich als Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”.
IV: Wissenschaft ist öffentliches Wissen, punctum.
Dass also Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”, das war die materiale Voraussetzung der modernen Wissenschaften. Die formale Voraussetzung war: Kritizität, und auch die hatte die Philosoühie begründet. Der Rahmen, in dem Philosophie seit ihren Anfängen Statt findet, ist Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit und Kritik, Kritik und Öffentlichkeit, das ist schlechterdings dasselbe. Philosophie wird nicht privat betrieben, sondern im Dialog mit dem anders Denkenden. Heraklit polemisierte gegen den gesunden Menschenverstand, Parmenides polemisierte gegen Heraklit, die Sophisten gegen Parmenides, Plato gegen die Sophisten. Und immer so weiter. Es entstehen Schulen, Akademien und freilich auch geheime Orden und Sekten wie Stoiker und Pythagoreer. Aber das Entscheidende: Sie alle konkurrieren auf dem freien Markt der Ideen.
Das gilt auch, allen Vorurteilen zum Trotz, von der Philosophie des “finsteren” Mittel- alters. Zwar galt sie damals als “Magd der Theologie” (ancilla theologiae), aber es kommt schon darauf an, wie Kant später bemerkte, ob die Magd der gnädigen Frau die Schleppe hinterher trägt oder ihr mit dem Licht voran den Weg weist! Und der wesentlich Beitrag der Scholastiker zum Aufkommen der modernen Wissenschaften war, dass sie ihnen ihr Medium geschaffen haben: die “Gelehrtenrepublik” (res publica eruditorum) an den Universitäten von Palermo bis Uppsala, von Dublin bis Wilna, wo nur eine Sprache, Latein, gesprochen wurde, und keiner etwas von sich geben konnte, ohne dass es nicht gleich auf dem (damals) schnellsten Wege von allen andern einer kritischen Sichtung unterzogen wurde. Und die waren in ihrer Kritik nicht zimperlich! Erst so ist das Wissen zu einer gesellschaftlichen Instanz geworden. Erst durch diesen Vorlauf konnten die Akademien und wissenschaftlichen Societäten entstehen, in denen Newton und Leibniz das, was wir heute als “Wissenschaft” kennen, gründen konnten.
Dabei war das Bewusstsein, dass wahres Wissen immer von der Möglichkeit der Letztbegründung abhängt, Newton ebenso gegenwärtig wie Leibniz. Philosophiae naturalis principia mathematica heißt sein Hauptwerk, und Leibniz ist bis heute selbst in der Umgangssprache als der Denker der “prästabilierten Harmonie” präsent.
Aber das war eben jene Metaphysik, der die Drei Kritiken von Immanuel Kant für immer den Garaus gemacht haben. Verzichtet also die Wissenschaft seither auf einen ‘letzten Grund’ ihres Wissens? Auf die Frage nach Wahrheit? Na ja. Wir können sehr wohl erkennen, was unter gegebenen Prämissen wahr ist. Freilich: Wahr ist es nur so fern, wie ich die Prämissen ausdrücklich mit denke. Und wer verbürgt nun die Richtigkeit dieser Prämissen? Kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Es ist die Republik der Wissenschaftler, die das tut, Tag für Tag aufs Neue, und ihr gehört jeder an, der am Werk der unablässigen Überprüfung mit arbeitet (auf das Risiko hin, dass ihm alle andern in die Waden beißen: Das gehört dazu.)
Der Wahrheitsbegriff der modernsten Wissenschaften beruht auf einem Modus, den der Wiener Volksmund umschreibt als “einstweilen definitiv”. Die ‘letzten Gründe’, von denen sie ausgeht, sind dasjenige, was seit nunmehr vierzig Jahren als ihre Paradigmen bekannt ist, und wie sehr es in der Wissenschaft heute wie eh um Wahrheit zu tun ist, erkennt man an den so genannten “Paradigmen- wechseln”, die das Unterste zu oberst kehren und der Nachwelt jeweils wie eine ‘wissenschaftliche Revolution’ erscheinen.
Glauben kann man das, was wahr ist, und was unwahr ist. Wissen kann man nur, was wahr ist. Alles andre müsste man glauben.
Wissen ist das, was der öffentlichen Prüfung durch die Gemeinschaft aller Denkenden Stand gehalten hat. Das ist “Maß und Substanz” der Wissenschaft. Es ist ein pragmatischer Begriff. Er muss sich jedesmal bewähren. So wie sich in der Öffentlichkeit ein Jeder jedesmal bewähren muss.
Exkurs
Im Schulunterricht wird es oft so dargestellt, als habe Galileo durch
die Einführung des Experiments die Naturkunde zu einer
Erfahrungswissenschaft umgestaltet. Das muss man mit den Worten Albert
Einsteins relativieren: dass die Erfahrung eine Theorie bestätigen oder
widerlegen könne; doch führt keine Weg aus der Erfahrung zur Theorie.
Anders gesagt: Das Experiment dient dazu, eine Theorie zu überprüfen,
aber ersonnen muss man sie vorher haben. Steven Weinberg [Physik-Nobelpreis 1979]
nennt es ein Vorurteil, dass es in der Wissenschaft darauf ankomme,
keine Vorurteile zu haben. Es kommt darauf an, die richtigen Vorurteile
zu haben.
Und hier kommt Galileo wieder ins Spiel! Er hat nämlich (auf die Philosophie Platos zurückgreifend) in die Physik das Vorurteil eingeführt, “das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben”. Indem die Mathematik eine jedermann zugängliche, für jedermann zwingend beweisbare Methode der gedanklichen Konstruktion ist, hat er so die Naturwissenschaft zu einer allgemein zugänglichen Öffentlichkeit gemacht. Und hier kommt nun auch das Experiment zu seinem Recht, denn es hat dieselbe Funktion: Indem die Versuchsanordnungen von jedermann allerorten jederzeit nachgestellt werden können, macht er nicht mehr nur die Erarbeitung, sondern auch die Überprüfung der Theorie zu einer öffentlichen Angelegenheit.
Der Empirismus im engeren Sinn ist eine durch Francis Bacon begründete Unterströmung in der (insgesamt von Isaac Newton’s mathematischem Rationalismus beherrschten) englischen Naturwissenschaft des 17. und 18. Jahrhundert. Ihm diente das Experiment hauptsächlich dazu, Alchemie und ärztliche Kunst aus dem Dunst des Okkulten zu holen und öffentlicher Erörterung allererst zugänglich zu machen.
Merke: Der Naturwissenschaftler beobachtet keines Wegs “die Natur” so lange, bis sie ihm von allein ein Lied singt. Vielmehr reißt er aus der Natur vorsätzlich ein winziges Stückchen heraus, zwingt es in die Folterkammer seines Labors und quält es kunstvoll so lange, bis es auf seine gezielten Fragen mit Ja oder Nein antwortet.
Und hier kommt Galileo wieder ins Spiel! Er hat nämlich (auf die Philosophie Platos zurückgreifend) in die Physik das Vorurteil eingeführt, “das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben”. Indem die Mathematik eine jedermann zugängliche, für jedermann zwingend beweisbare Methode der gedanklichen Konstruktion ist, hat er so die Naturwissenschaft zu einer allgemein zugänglichen Öffentlichkeit gemacht. Und hier kommt nun auch das Experiment zu seinem Recht, denn es hat dieselbe Funktion: Indem die Versuchsanordnungen von jedermann allerorten jederzeit nachgestellt werden können, macht er nicht mehr nur die Erarbeitung, sondern auch die Überprüfung der Theorie zu einer öffentlichen Angelegenheit.
Der Empirismus im engeren Sinn ist eine durch Francis Bacon begründete Unterströmung in der (insgesamt von Isaac Newton’s mathematischem Rationalismus beherrschten) englischen Naturwissenschaft des 17. und 18. Jahrhundert. Ihm diente das Experiment hauptsächlich dazu, Alchemie und ärztliche Kunst aus dem Dunst des Okkulten zu holen und öffentlicher Erörterung allererst zugänglich zu machen.
Merke: Der Naturwissenschaftler beobachtet keines Wegs “die Natur” so lange, bis sie ihm von allein ein Lied singt. Vielmehr reißt er aus der Natur vorsätzlich ein winziges Stückchen heraus, zwingt es in die Folterkammer seines Labors und quält es kunstvoll so lange, bis es auf seine gezielten Fragen mit Ja oder Nein antwortet.
V. Wurde die Mathematik aus der Natur heraus-gefunden…
…oder vom Menschenhirn in sie hinein-gedacht?

Erst
mit Galileo ging, streng genommen, das mythische Zeitalter zu Ende.
“Der Mythos braucht keine Fragen zu beantworten. Er erfindet, bevor die
Frage akut wird und damit sie nicht akut wird.”(Hans Blumenberg). Seit
Galileo stellen die Wissenschaften nicht nur Fragen, sondern beantworten
sie auch, und jede Antwort wirft (mindestens) eine neue Frage auf.
Das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben, hatte Galileo verkündet. Das ist seither zum Gemeinplatz westlicher Bildung geworden. Descartes hatte die Welt in zwei Substanzen zerteilt, eine res extensa, die Materie, die sich durch ihre räumliche Ausdehnung zu erkennen gibt, und die res cogitans, den Geist, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Doch eines ist ihnen gemeinsam: die mathematische Struktur, und an der erkennt man ihre gemeinsame Abkunft vom selben Schöpfergott. Spinoza tat die beiden Teile wieder zusammen, bei ihm ist es die eine, geistige Substanz, die sich selber ausdehnt, “deus sive natura”, und wie tut sie das? “More geometrico”, auf geometrische Weise! War bei Descartes Gott ein Mathematiker, so ist die Gottnatur bei Spinoza Mathematik. Isaac Newton, der erste Systematiker der modernen Physik, betitelte sein Hauptwerk ” Philosophiae naturalis principia mathematica”, die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Und Leibniz endlich, der die strenge Naturwissenschaft in Deutschland eingeführt hat, überlegte ernstlich, ob nicht Gott selber in mathematischen Formel dächte.
Die Herrschaft des Rationalismus war Herrschaft der Metaphysik. Die Metaphysik sei aus der abendländischen Wissenschaft inzwischen vertrieben? Nur die metaphysische Verpackung ist gefallen. Der Kern bleibt. Der Einfall, die Gesetze der Mathematik seien gleichzeitig die Gesetze der Vernunft und der Natur, bedarf keiner zusätzlichen Metaphysik. Er ist selber metaphysisch.
Die Mathematik ist nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr Interesse auf die Arithmetik konzentriert; aber sie dienten ihnen nur zur Astrologie. Mathematik entstand erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion. Auf etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden.
Aber ist nicht gerade die Geometrie aus den Dingen der Welt abgeschaut?!
Plato kannte fünf vollkommene Körper: Kugel, Würfel, Pyramide; Zylinder, Konus.
Es sind die jeweiligen dreidimensionalen Kombinationen von Kreis, Quadrat und Dreieck. Drei Dimensionen sind ‘vollkommener’ als zwei, bzw. Körper sind vollkommener als Flächen.
Hat man eines von denen ‘von der Natur abgeschaut’? Mehr oder minder runde Formen kommen in ‘der Natur’ vor; Kugeln nicht. Kugel ‘entsteht’ als Idee des vervollkommneten ‘runden’ Körpers. Wobei Vollkommenheit eben keine logische, sondern eine anschauliche, eine ästhetische Qualität ist! Finden sich Würfel, Pyramiden, Zylinder usw. in der Natur vor? Es finden sich Formen, die wie fehlerhafte Annäherungen aussehen. Damit sie so aussehen können, müssen die reinen Formen dem inneren Auge aber schon gewärtig sein. Und das geht nur, wenn das innere Auge die Konstruktion aus Kreis, Quadrat und Dreieck schon vorgenommen hat! Das ist eine erhebliche Abstraktions- und Reflexionsleistung.
(Abstraktion und Reflexion sind nur zwei Sichtweisen auf denselben Denkakt: Absehen auf das jeweils Wichtige ist zugleich Absehen von dem jeweils Unerheblichen.)
Denn zuvor mussten vor dem inneren Auge die Flächen selber konstruiert werden! Allein den vollkommenen Kreis kann man in der Außenwelt sehen – am wolkenlosen Himmel.
Es ist ja denkbar, dass der Anblick des einzig perfekten Kreises – der Sonnenscheibe – und ihrer imperfekten Parodie, des Mondes – den Anlass zur Idee anschaulicher Vollkommenheit gegeben hat; aber eine erfahrungsmäßige Abstraktion aus dem Anblick vieler perfekten Kreise war es nicht: weil es nur diesen einen gibt; und eine Reihe imperfekter Karikaturen – die werdenden und vergehenden Ringe auf dem Wasser usw… Nachgemacht werden kann dieser eine perfekte Kreis aber nicht auf ‘anschaulichem’ Weg; er muss konstruiert werden aus Punkt und Radius: wieder eine Abstraktionsleistung.
Die andern beiden Grundformen finden sich nicht in perfekter Gestalt in den Natur vor. Sie müssen – vielleicht in anschaulicher Analogie zur Sonnenscheibe – erdacht werden, um bemerken zu können, dass sich in der Natur… unvollkommene Annäherungen vorfinden.
Und erst nach all dem können die fünf perfekten Körper erdacht werden; und kann man sich einbilden, diese Idealentwürfe lägen ihren unvollständigen natürlichen Nachbildungen “in Wahrheit” zu Grunde; in einer verborgenen Wahrheit selbstverständlich.
Die Arithmetik hat ältere Wurzeln, die bis zu den Babyloniern zurückreichen. Ist nun die Zahl ein “Naturverhältnis”? Beruht sie nicht darauf, dass die Dinge ‘im Raum’ eine Grenze haben und man sie neben einander stellen und also zählen kann? Das sieht nur so aus. Tatsächlich zählen wir die Dinge nicht neben-, sondern nach einander! Und das geschieht in der Zeit.
Paläoanthropologen haben aus frühester Vorzeit Stäbchen geborgen, die in regelmäßigen Abständen mit Kerben versehen sind. Sie interpretieren sie als Zählstäbe, die Vorläufer der Zahlensysteme; nämlich so, dass ihre Hersteller den Daumennagel auf die erste Kerbe gehalten haben: “zuerst…”; auf die zweiter Kerbe: “dann…”; dritte Kerbe: “und danach…”. Da wird das zeitliche Nacheinander der Zahlen archäologisch sinnfällig!
Und wem die erwähnten Zählstäbe der Paläontologen als Indiz zu dürftig scheinen, der kann es ja mit einem Gedankenexperiment versuchen.
Was immer Zahlen sonst auch noch sein mögen, eins sind sie ganz bestimmt: Zeichen. Was muss man bezeichnen? Etwas, das man nicht stets vor Augen hat und doch ‘behalten’ will. Denn auf alles andere kann man mit dem Finger zeigen. Kleine Mengen hat man stets vor Augen: 3 Äpfel, 4 Beine usw. Bezeichnen müsste man größere Mengen. Mit welchen größeren Mengen könnten aber unsere Vorfahren – ihres Zeichens Jäger und Sammler – regelmäßig zu tun gehabt haben? So regelmäßig, dass sie sie dauerhaft bezeichnen mussten?!
Sie waren Nomaden; große Vorräte kannten sie nicht. Bleibt also übrig – die Zeit. Die Zeiträume müssen bezeichnet werden: wie viele Tage bis Vollmond, Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche, Jahreszeiten, Jahre… Gerade Nomaden, die ihr Leben buchstäblich durch Zeit und Raum führen, müssen mental Zeiträume ‘vorweg nehmen’ können, müssen wissen, ‘wie lange wir brauchen bis…’ – z. B. bis zur nächsten Wasserstelle. Denn solange sie keine Wanderkarten und keine Tachometer haben, können sie Wege nur als Zeit darstellen. (Noch im Mittelalter wurden Ackergrößen als ‘Tagewerke’ gemessen.)
Sagt nicht aber schon der gesunde Menschenverstand, dass eins und ein zwei sind? ‘Ursprünglich’, d. h. in unmittelbarer sinnlicher Anschauung, kommen Zahlen nur als Ordnungszahlen vor: als Nacheinander in einem ‘an sich’ ununterschiedenen Zeitverlauf: erstens, zweitens, drittens… zählen kann ich so noch nicht. Denn es könnte bedeuten: erstens ein Lufthauch, zweitens ein Elefant, drittens eine Untertasse. Um aus den Momenten im Zeitverlauf ein Werkzeug (”Denkzeug”) zum Zählen zu machen, muss ich von der Zeit selber absehen und auf die zu zählenden Sachen reflektieren.
Das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben, hatte Galileo verkündet. Das ist seither zum Gemeinplatz westlicher Bildung geworden. Descartes hatte die Welt in zwei Substanzen zerteilt, eine res extensa, die Materie, die sich durch ihre räumliche Ausdehnung zu erkennen gibt, und die res cogitans, den Geist, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Doch eines ist ihnen gemeinsam: die mathematische Struktur, und an der erkennt man ihre gemeinsame Abkunft vom selben Schöpfergott. Spinoza tat die beiden Teile wieder zusammen, bei ihm ist es die eine, geistige Substanz, die sich selber ausdehnt, “deus sive natura”, und wie tut sie das? “More geometrico”, auf geometrische Weise! War bei Descartes Gott ein Mathematiker, so ist die Gottnatur bei Spinoza Mathematik. Isaac Newton, der erste Systematiker der modernen Physik, betitelte sein Hauptwerk ” Philosophiae naturalis principia mathematica”, die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Und Leibniz endlich, der die strenge Naturwissenschaft in Deutschland eingeführt hat, überlegte ernstlich, ob nicht Gott selber in mathematischen Formel dächte.
Die Herrschaft des Rationalismus war Herrschaft der Metaphysik. Die Metaphysik sei aus der abendländischen Wissenschaft inzwischen vertrieben? Nur die metaphysische Verpackung ist gefallen. Der Kern bleibt. Der Einfall, die Gesetze der Mathematik seien gleichzeitig die Gesetze der Vernunft und der Natur, bedarf keiner zusätzlichen Metaphysik. Er ist selber metaphysisch.
Die Mathematik ist nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr Interesse auf die Arithmetik konzentriert; aber sie dienten ihnen nur zur Astrologie. Mathematik entstand erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion. Auf etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden.
Aber ist nicht gerade die Geometrie aus den Dingen der Welt abgeschaut?!
Plato kannte fünf vollkommene Körper: Kugel, Würfel, Pyramide; Zylinder, Konus.
Es sind die jeweiligen dreidimensionalen Kombinationen von Kreis, Quadrat und Dreieck. Drei Dimensionen sind ‘vollkommener’ als zwei, bzw. Körper sind vollkommener als Flächen.
Hat man eines von denen ‘von der Natur abgeschaut’? Mehr oder minder runde Formen kommen in ‘der Natur’ vor; Kugeln nicht. Kugel ‘entsteht’ als Idee des vervollkommneten ‘runden’ Körpers. Wobei Vollkommenheit eben keine logische, sondern eine anschauliche, eine ästhetische Qualität ist! Finden sich Würfel, Pyramiden, Zylinder usw. in der Natur vor? Es finden sich Formen, die wie fehlerhafte Annäherungen aussehen. Damit sie so aussehen können, müssen die reinen Formen dem inneren Auge aber schon gewärtig sein. Und das geht nur, wenn das innere Auge die Konstruktion aus Kreis, Quadrat und Dreieck schon vorgenommen hat! Das ist eine erhebliche Abstraktions- und Reflexionsleistung.
(Abstraktion und Reflexion sind nur zwei Sichtweisen auf denselben Denkakt: Absehen auf das jeweils Wichtige ist zugleich Absehen von dem jeweils Unerheblichen.)
Denn zuvor mussten vor dem inneren Auge die Flächen selber konstruiert werden! Allein den vollkommenen Kreis kann man in der Außenwelt sehen – am wolkenlosen Himmel.
Es ist ja denkbar, dass der Anblick des einzig perfekten Kreises – der Sonnenscheibe – und ihrer imperfekten Parodie, des Mondes – den Anlass zur Idee anschaulicher Vollkommenheit gegeben hat; aber eine erfahrungsmäßige Abstraktion aus dem Anblick vieler perfekten Kreise war es nicht: weil es nur diesen einen gibt; und eine Reihe imperfekter Karikaturen – die werdenden und vergehenden Ringe auf dem Wasser usw… Nachgemacht werden kann dieser eine perfekte Kreis aber nicht auf ‘anschaulichem’ Weg; er muss konstruiert werden aus Punkt und Radius: wieder eine Abstraktionsleistung.
Die andern beiden Grundformen finden sich nicht in perfekter Gestalt in den Natur vor. Sie müssen – vielleicht in anschaulicher Analogie zur Sonnenscheibe – erdacht werden, um bemerken zu können, dass sich in der Natur… unvollkommene Annäherungen vorfinden.
Und erst nach all dem können die fünf perfekten Körper erdacht werden; und kann man sich einbilden, diese Idealentwürfe lägen ihren unvollständigen natürlichen Nachbildungen “in Wahrheit” zu Grunde; in einer verborgenen Wahrheit selbstverständlich.
Die Arithmetik hat ältere Wurzeln, die bis zu den Babyloniern zurückreichen. Ist nun die Zahl ein “Naturverhältnis”? Beruht sie nicht darauf, dass die Dinge ‘im Raum’ eine Grenze haben und man sie neben einander stellen und also zählen kann? Das sieht nur so aus. Tatsächlich zählen wir die Dinge nicht neben-, sondern nach einander! Und das geschieht in der Zeit.
Paläoanthropologen haben aus frühester Vorzeit Stäbchen geborgen, die in regelmäßigen Abständen mit Kerben versehen sind. Sie interpretieren sie als Zählstäbe, die Vorläufer der Zahlensysteme; nämlich so, dass ihre Hersteller den Daumennagel auf die erste Kerbe gehalten haben: “zuerst…”; auf die zweiter Kerbe: “dann…”; dritte Kerbe: “und danach…”. Da wird das zeitliche Nacheinander der Zahlen archäologisch sinnfällig!
Und wem die erwähnten Zählstäbe der Paläontologen als Indiz zu dürftig scheinen, der kann es ja mit einem Gedankenexperiment versuchen.
Was immer Zahlen sonst auch noch sein mögen, eins sind sie ganz bestimmt: Zeichen. Was muss man bezeichnen? Etwas, das man nicht stets vor Augen hat und doch ‘behalten’ will. Denn auf alles andere kann man mit dem Finger zeigen. Kleine Mengen hat man stets vor Augen: 3 Äpfel, 4 Beine usw. Bezeichnen müsste man größere Mengen. Mit welchen größeren Mengen könnten aber unsere Vorfahren – ihres Zeichens Jäger und Sammler – regelmäßig zu tun gehabt haben? So regelmäßig, dass sie sie dauerhaft bezeichnen mussten?!
Sie waren Nomaden; große Vorräte kannten sie nicht. Bleibt also übrig – die Zeit. Die Zeiträume müssen bezeichnet werden: wie viele Tage bis Vollmond, Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche, Jahreszeiten, Jahre… Gerade Nomaden, die ihr Leben buchstäblich durch Zeit und Raum führen, müssen mental Zeiträume ‘vorweg nehmen’ können, müssen wissen, ‘wie lange wir brauchen bis…’ – z. B. bis zur nächsten Wasserstelle. Denn solange sie keine Wanderkarten und keine Tachometer haben, können sie Wege nur als Zeit darstellen. (Noch im Mittelalter wurden Ackergrößen als ‘Tagewerke’ gemessen.)
Sagt nicht aber schon der gesunde Menschenverstand, dass eins und ein zwei sind? ‘Ursprünglich’, d. h. in unmittelbarer sinnlicher Anschauung, kommen Zahlen nur als Ordnungszahlen vor: als Nacheinander in einem ‘an sich’ ununterschiedenen Zeitverlauf: erstens, zweitens, drittens… zählen kann ich so noch nicht. Denn es könnte bedeuten: erstens ein Lufthauch, zweitens ein Elefant, drittens eine Untertasse. Um aus den Momenten im Zeitverlauf ein Werkzeug (”Denkzeug”) zum Zählen zu machen, muss ich von der Zeit selber absehen und auf die zu zählenden Sachen reflektieren.
Vorab:
Warum, wozu sind sie ‘zu’ zählen? Es braucht zunächst einmal eine
Absicht; zum Beispiel die Absicht, Sachen zu verteilen. Ich verteile
Sachen, die ‘in einer gewissen Hinsicht’ gleich sind, auf so
und so viele Posten, die ihrerseits in gewisser Hinsicht gleich sind;
zum Beispiel Essbares an Hungrige. Ich muss aus der Mannigfaltigkeit der
Sachen dasjenige heraus suchen, das sich unter der Bedeutung des
Essbaren zusammenfassen lässt. Danach muss ich auf diejenigen achten,
die mir als hungrig bekannt sind. Erst dann kann ich aus den Ordnungszahlen erstens, zweitens, drittens… die Zahlen 1, 2, 3… abstrahieren.
Und erst, nachdem all diese Denkleistungen vollbracht wurden, kann von “Erfahrung” geredet werden. Erfahrung ist nicht das bloße Registrieren von Erlebensdaten, sondern ihre sinnvolle Unterscheidung und Anordnung. Die Absicht geht voraus. Ohne vorgängige Absicht keine vorfindliche Bedeutung.
Und erst, nachdem all diese Denkleistungen vollbracht wurden, kann von “Erfahrung” geredet werden. Erfahrung ist nicht das bloße Registrieren von Erlebensdaten, sondern ihre sinnvolle Unterscheidung und Anordnung. Die Absicht geht voraus. Ohne vorgängige Absicht keine vorfindliche Bedeutung.
VI: Ist die Welt logisch aufgebaut?
Wenn aber die Mathematik Menschenwerk ist – wie konnte sie sich dann nur so blendend in den Naturwissenschaften bewähren? Vielleicht doch, weil sie (’zufällig’) zugleich den inneren Bauplan der Natur wiedergibt?!
Nun ja: Worin besteht ‘Naturwissenschaft’? Darin, dass der Forscher sich bemüht, die tatsächlichen Vorgänge in der Außenwelt in einem abstrakten Modell nach-zu-konstruieren! Und dann ist es kein Wunder, dass er die Konstruktions- anleitungen, die er vorher ins Modell hinein-konstruiert hat, hinterher auch wieder heraus-”findet”!
Der modische Ausdruck “Konstruktivismus” stammt übrigens aus der sogenannten “Erlanger Schule” der Mathematik, die in den 50er Jahren um Paul Lorenzen herum genau diese These in die Mathematik hineingetragen hat: dass es sich nämlich um eine konstruktive Disziplin handelt.
Die Kernfrage der Naturwissenschaft lautet: Steckt die ‘gesetzmäßige’ Ordnung der Welt in der Welt selber oder ‘bloß’ in unsern Köpfen? Die Naturwissenschaft hält diese Frage für “metaphysisch” und reicht sie dankend an die Philosophie weiter. Die hat sich aber längst unter die Fuchtel der Naturwissenschaft gestellt und hält sie ebenfalls für metaphysisch.
Das ist sie zwar auch, aber nicht nur. Die Frage, ob Vernunft etwas ist, das wir “vernehmen”, wenn wir aufmerksam in die Natur lauschen – und so erfahren, was wir auf der Welt sollen; oder ob Vernunft unsre eigene Erfindung ist und aus ihr nur herausgeholt werden kann, was man vorher in sie hineinsteckt – die betrifft überdies jedermanns persönliche Lebensführung.
‘Logisch’ bedeutete bei den ganz alten Griechen lediglich ‘das auf den Logos Bezogene’. Damit war alles irgendwie Sinnhafte gemeint, warum denn nur gesetzte Begriffe und nicht auch unfassliche Bilder? Seit Aristoteles aber wird unter Logik die Kunst (techné) des richtigen Schlussfolgerns verstanden. Als formale Logik wurde sie von den mittelalterlichen Scholastikern systematisiert und gewissermaßen ‘vollendet’. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurde sie dann so formalisiert, dass sie gelegentlich wie ein Grenzfall des Mathematischen aussieht.
Die Kunst des Schließens ist aber nicht das Vermögen des Vorstellens. Um Einfälle zu haben, muss man nicht aus Prämissen Folgerungen ziehen, sondern… einen Einfall haben. Was er taugt, muss dann freilich beurteilt werden; vorausgesetzt, man hat schon einen Zweck, eine “Absicht”, für die er taugen soll. Dann braucht man die Logik als einen Kanon, nach dem geurteilt wird. Kann der Einfall nach den Regeln des Kanons nach-”vollzogen” werden, dann taugt der Einfall...
Die Frage “Ist die Welt logisch aufgebaut?” ist dieselbe Frage wie: “Ist Mathematik entdeckt oder erfunden?” Weil sich die Welt in einer ganz gewissen Hinsicht in pragmatisch erfundenen mathematischen Sätzen beschreiben lässt, kann der Eindruck entstehen, deren Folgerichtigkeit habe in der Welt schon selber drin gesteckt. Das ist das, was Kant den “dialektischen Schein” genannt hat. Es ist die Aufgabe philosophischer Kritik, diesen Schein zu zerstreuen.
Mathematik ist Konstruktionslehre. Sie beschreibt in ihrem Zeichensystem, zu welchen Konstrukten ich gelange, wenn ich im Reich der Zahlen (=idealiter: in der Zeit; “wie oft?”) diese und im (idealen) Raum (”wo lang?”) jene Operation anstelle.
Warum lässt sich die Mathematik “auf die Welt der Dinge anwenden”? Weil ich mir die Welt der Dinge so vorstellen kann, als ob ich sie selber konstruiert hätte; dann beschreibt die Mathematik in ihrem Zeichensystem, wie ich hätte verfahren müssen, um sie so zu konstruieren.
Mathematik ist das allgemeine operative Schema der möglichen Handlungen in Raum und Zeit. Logik ist das allgemeine Schema der möglichen Handlungen in der bloßen Vorstellung.
VII: Der Sinn und das Sein, oder: Die metaphysische Fußangel
Seit Galileo, Descartes und Newton ist der westliche Mensch überzeugt, mit der Mathematik den Schlüssel der Natur in den Händen zu halten. Mehr als das. Bei den Schwärmern wie den esoterischen Schmähern der Vernunft, die alle halb Jahrhunderte Konjunktur haben, gilt die Mathematik als deren ‘Paradigma’ und als Modell alles Logischen.
 Und
tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben
der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der
mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften
durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und
Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen
Weltanschauung den Boden bereitet hat?
Und
tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben
der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der
mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften
durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und
Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen
Weltanschauung den Boden bereitet hat?
Das 17. und 18. Jahrhundert war das Zeitalter der großen metaphysischen Systeme. Die mathematische Weltsicht ist allen gemeinsam: Descartes-Malebranche, Spinoza, Leibniz-Wolff und – nicht zu vergessen – Thomas Hobbes. Der Bedarf an Metaphysik war akut. Die in blutigen Kriegen zerrissene Religion hatte aufgehört, den Menschen Gewissheit und Orientierung zu geben. Die brauchten sie aber so nötig wie nie. Wie die katholische Kirche war die ständische Gesellschaftsordnung in den Grundfesten erschüttert. Das Bürgertum schickte sich an, ihre Erbschaft anzutreten. Es suchte nach einer neuen, eigenen Weltanschauung, in der sie ihre Wege vorgezeichnet finden und ihre Taten gerechtfertigt finden konnte.
Der Zweck der Metaphysik ist nicht derjenige der Naturwissenschaft. Wenn sie nach dem Sein fragt, dann meint sie in Wahrheit dessen Sinn. Den trägt sie aber heimlich schon lange in ihrer Brust: Rechenhaftigkeit. Wenn es gelingt, das ureigne Wesen des ganzen großen Universums als ein Rechenexempel zu konstruieren; wenn es zugleich gelingt, daraus das Sosein eines jeden Einzelnen als Bestand-Teil eines (’autopoietischen’, würde man heute sagen) Systems herzuleiten – dann war es klar, dass der Sinn im Einzelnen nur der Sinn des großen Ganzen sein kann. ‘Rationalität’ muss der Sinn der Welt sein, damit sie der Sinn des Lebens sein kann.
Öffentlichkeit ist das Feld, auf dem die Metaphysik gegen die Religion antritt. An die Stelle der konfessionell reglementierten Universitäten treten Gelehrtengesellschaften, die mit dem gebildeten Bürgertum in engster Beziehung stehen, intellektuell und finanziell, und in der Druckerpresse verfügen sie gegen die Kanzeln über eine mächtige Waffe. And die Stelle der Autorität tritt das Argument.
Wenn die Metaphysik nach dem Sein fragt, meint sie in Wahrheit seinen Sinn – war das womöglich schon immer so? Damit hatte die Philosophie begonnen: der Frage nach dem “wahren Sein”. Stand hinter der theoretischen Frage ‘Was ist?’ schon damals die praktische Frage ‘Was soll ich tun’?
 Tatsächlich
stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der
Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen
Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,
nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.
Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir
per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur
annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus
einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht
beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.
Tatsächlich
stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der
Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen
Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,
nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.
Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir
per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur
annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus
einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht
beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.
VIII: Kausalität, oder Der Mythos vom Allverursacher
IX. Aus der Nische in die Welt, oder: Warum die Menschen aufrecht gehen

Das ist eine Dimension, die sich der Mensch selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Doch auch das Tier lebt nicht in einer Welt, die ‘der Fall ist’, sondern in Bedeutungen. Evolution ist Auslese und Anpassung. Im Laufe ihrer Geschichte hat jede Spezies ihre ökologische Nische gefunden und hat sie zu ihrer Umwelt eingerichtet. Jede tierische Umwelt bildet nach Jakob von Uexküll, dem Begründer des biologischen Umwelt-Begriffs, “eine in sich geschlossene Einheit, die in all ihren Teilen durch die Bedeutung für das Subjekt beherrscht wird. Alles und jedes, das in den Bann einer Umwelt gerät, wird umgestimmt und umgeformt, bis es zu einem brauchbaren Bedeutungsträger geworden ist – oder es wird völlig vernachlässigt.”
Was die Dinge seiner Umwelt dem Tier bedeuten, “versteht sich von selbst” – da muss es das Tier nicht auch noch verstehen. Die Gattung und ihre Umwelt sind gewissermaßen durch Vererbung miteinander verwandt. Dem Menschen werden die Bedeutungen der Dinge durch Symbole mitgeteilt, die ihm von andern Menschen überliefert wurden: Deren Bedeutungen muss er jedesmal wieder selber realisieren, nämlich verstehen.
XI: Der Sündenfall, oder: Arbeit ist der Sinn des Lebens
 Am
Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen
Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und
dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.
Das war die Erfindung des Ackerbaus vor
vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung
der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er
funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden
muß.
Am
Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen
Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und
dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.
Das war die Erfindung des Ackerbaus vor
vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung
der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er
funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden
muß.
Das ist die Logik der Arbeitsteilung: die Reduktion der Qualitäten auf komplex zusammengesetzte Quantitäten; das Absehen von der Stoff- und das Hervorkehren der Formseite; die Auflösung einer jeden Substanz in ihr Herstellungsverfahren; die Reduktion der Sache auf die Mache. Wir reden von “Tat”sachen, und wenn wir ihre ‘qualitas’ meinen, sagen wir
“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”
zurück führen.
‘qualitas’ meinen, sagen wir
“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”
zurück führen.
XIII. Unsere Welt und die meine

 Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,
dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich
sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt
an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen
Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!
Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,
dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich
sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt
an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen
Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!
XIV: Ein erster, letzter Grund oder: Der schöne Schein des Wahren

Ursprung und Angelpunkt des abendländischen Denkens war die Frage nach dem Wahren. In der Sinnenwelt ist alles Trug. Sie scheint mal so, mal so, je nach Standort. Alles, was wird, wird vergehen. Wahr ist, was währt, das ewige Sein; doch es liegt unterm Werden verhüllt. Nur dem Denken ist es kenntlich, „denn dasselbe ist Denken und Sein“, sagt Parmenides. Die Frage nach dem wahren Sein ist die Frage, wonach sich mein Leben in der Mannigfaltigkeit trügerischer Erscheinungen richten soll.
Man erkennt es beim Vergleich mit Heraklit, gegen den Parmenides angetreten war: Nicht zweimal könne man in einen Fluss steigen; der Fluss sei ein anderer geworden und der Mensch auch. Hinter dem Werden ist Nichts, wahr ist der Schein: Das möchte man einen heroischen Nihilismus nennen; ein aristokratisches Leben auf eigne Faust, das sich nicht jeder leisten kann. Die Vermutung, daß der Sinn der Welt zwar verborgen, aber jedenfalls in ihr liegt, macht dagegen auch kleinen Leuten Mut. Nicht anders konnte die Arbeitsgesellschaft siegen, nicht anders konnte Europa die Welt erobern.
 Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,
ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er
aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,
und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb
Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von
welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer
uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.
Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die
Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,
ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er
aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,
und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb
Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von
welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer
uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.
Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die
Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
Das ist nicht bloß eine Idee. Das ist eine ästhetische Idee. Es ist, recht besehen, die ästhetische Idee schlechthin, die in alle tatsächlich vorkommenden Bestimmungen nach Ort und Zeit vorgängig hineingreift, die all die Qualitäten vereint, die ich an den Dingen “wertnehme”, bevor ich sie wahrnehme, und von der ich erst durch eine besondere Anstrengung des reflektierenden Verstandes wieder abstrahieren kann.
Es “ist” nicht so. Aber so muss ich es mir vorstellen, wenn ich mir überhaupt Etwas vorstellen will. Das Wissen kann seinen eignen Grund nicht erkennen. Es muss ihn sich ein-bilden. Der höchste Akt der Vernunft sei ein ästhetischer, hieß es im ‘Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus’. Ob er wirklich stattgefunden hat, ist nicht entscheidend. Es scheint uns so, als ob er stattgefunden hätte. Er ist so wahr wie ein Mythos sein kann. Will sagen, er muss sich bewähren.
Bewähren in Sonderheit in meinem täglichen Tun und Lassen – als Sittlichkeit. “Die Ethik ist transzendental“, schrieb Ludwig Wittgenstein, um gleich hinzu zu fügen: “Ethik und Ästhetik sind eins.” Und es sei klar, dass sie sich als solche “nicht aussprechen” lassen.
<
In den Wörtern unserer Welt lassen sie sich nicht aussprechen. Denn sie gehören zu meiner Welt. Den andern kann ich sie allenfalls zeigen – in den Bildern der Kunst. In Wörtern lässt sich das Problem immer nur so formulieren: Der Sinn des Lebens ist, dass du nach ihm fragst. Eben ein heroischer Nihilismus oder, wenn man will, “Artisten-Metaphysik”. Auf jeden Fall ist es eine romantische Anschauung der Welt, und eine fröhliche.

XV. Wozu noch philosophieren?
Muss man wollen?
abwärts
Seit Galileo, Descartes und Newton ist der westliche Mensch überzeugt, mit der Mathematik den Schlüssel der Natur in den Händen zu halten. Mehr als das. Bei den Schwärmern wie den esoterischen Schmähern der Vernunft, die alle halb Jahrhunderte Konjunktur haben, gilt die Mathematik als deren ‘Paradigma’ und als Modell alles Logischen.
 Und
tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben
der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der
mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften
durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und
Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen
Weltanschauung den Boden bereitet hat?
Und
tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben
der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der
mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften
durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und
Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen
Weltanschauung den Boden bereitet hat?Das 17. und 18. Jahrhundert war das Zeitalter der großen metaphysischen Systeme. Die mathematische Weltsicht ist allen gemeinsam: Descartes-Malebranche, Spinoza, Leibniz-Wolff und – nicht zu vergessen – Thomas Hobbes. Der Bedarf an Metaphysik war akut. Die in blutigen Kriegen zerrissene Religion hatte aufgehört, den Menschen Gewissheit und Orientierung zu geben. Die brauchten sie aber so nötig wie nie. Wie die katholische Kirche war die ständische Gesellschaftsordnung in den Grundfesten erschüttert. Das Bürgertum schickte sich an, ihre Erbschaft anzutreten. Es suchte nach einer neuen, eigenen Weltanschauung, in der sie ihre Wege vorgezeichnet finden und ihre Taten gerechtfertigt finden konnte.
Der Zweck der Metaphysik ist nicht derjenige der Naturwissenschaft. Wenn sie nach dem Sein fragt, dann meint sie in Wahrheit dessen Sinn. Den trägt sie aber heimlich schon lange in ihrer Brust: Rechenhaftigkeit. Wenn es gelingt, das ureigne Wesen des ganzen großen Universums als ein Rechenexempel zu konstruieren; wenn es zugleich gelingt, daraus das Sosein eines jeden Einzelnen als Bestand-Teil eines (’autopoietischen’, würde man heute sagen) Systems herzuleiten – dann war es klar, dass der Sinn im Einzelnen nur der Sinn des großen Ganzen sein kann. ‘Rationalität’ muss der Sinn der Welt sein, damit sie der Sinn des Lebens sein kann.
Öffentlichkeit ist das Feld, auf dem die Metaphysik gegen die Religion antritt. An die Stelle der konfessionell reglementierten Universitäten treten Gelehrtengesellschaften, die mit dem gebildeten Bürgertum in engster Beziehung stehen, intellektuell und finanziell, und in der Druckerpresse verfügen sie gegen die Kanzeln über eine mächtige Waffe. And die Stelle der Autorität tritt das Argument.
Wenn die Metaphysik nach dem Sein fragt, meint sie in Wahrheit seinen Sinn – war das womöglich schon immer so? Damit hatte die Philosophie begonnen: der Frage nach dem “wahren Sein”. Stand hinter der theoretischen Frage ‘Was ist?’ schon damals die praktische Frage ‘Was soll ich tun’?
Die
Philosophie im engeren Sinne beginnt mit dem Gegensatz von Heraklit und
Parmenides, dem Gegensatz von ewigem Werden und ewigem Sein; einer am
östlichen, der andre am westlichen Rand der hellenischen Welt. Mit ihnen
beginnt der Anfang vom Ende des mythischen Zeitalters.
Ein Beinahe-noch-Zeitgenosse war Sophokles in Athen, dem Zentrum. Er überführte die Antigone aus dem Mythos in die Tragödie. Dort ist sie nicht mehr bloßes Opfer ihres Schicksals, sondern wählt zwischen Altem und Neuem Gesetz ihren Weg selber. Sie schwankt nicht wie Hamlet hin und her, so modern ist sie nicht. Ihre Wahl steht von Anbeginn fest. Aber modern ist: Es ist nicht die Zuflüsterung dieser oder jener Gottheit, sondern sie ist es selber, die gewählt hat.
Sophokles schrieb für die Öffentlichkeit des perikleischen Athen – in der Blüte der attischen Demokratie, die angewiesen war auf den eigen-sinnigen polites; den Bürger, der für seine Wahl mit allem einstand, das er hatte. Ohne ihn hätte Athen den Pelepponesichen Krieg nicht überlebt. In der Tragödie wird der Übergang vom Mythos zur Vernunft sinnfälliger als in der Philosophie selbst. Die griechische Polis trug deutliche Züge einer bürgerlichen Gesellschaft.
Ein Beinahe-noch-Zeitgenosse war Sophokles in Athen, dem Zentrum. Er überführte die Antigone aus dem Mythos in die Tragödie. Dort ist sie nicht mehr bloßes Opfer ihres Schicksals, sondern wählt zwischen Altem und Neuem Gesetz ihren Weg selber. Sie schwankt nicht wie Hamlet hin und her, so modern ist sie nicht. Ihre Wahl steht von Anbeginn fest. Aber modern ist: Es ist nicht die Zuflüsterung dieser oder jener Gottheit, sondern sie ist es selber, die gewählt hat.
Sophokles schrieb für die Öffentlichkeit des perikleischen Athen – in der Blüte der attischen Demokratie, die angewiesen war auf den eigen-sinnigen polites; den Bürger, der für seine Wahl mit allem einstand, das er hatte. Ohne ihn hätte Athen den Pelepponesichen Krieg nicht überlebt. In der Tragödie wird der Übergang vom Mythos zur Vernunft sinnfälliger als in der Philosophie selbst. Die griechische Polis trug deutliche Züge einer bürgerlichen Gesellschaft.
Dann
kamen das Römische Reich, die Völkerwanderung, der Verfall städtischer
Kultur und die Neugeburt Europas im Zeichen der Feudalität. Nicht die
Vernunft trat an die Stelle des Mythos, sondern die katholische Kirche.
Sie war so doppelsinnig wie das finstere, bunte, turbulente Mittelalter.
Zum einen war sie Dogma, aber zum andern lehrte sie, das Leben als eine
Pilgerfahrt aufzufassen, auf der man scheitern kann. Sie lehrte die
Menschen, auf ihr Gewissen zu achten – mehr, als es die antike Tragödie
vermocht hätte; und nur auf ihr Gewissen, wenn man es streng nahm. Der Mensch, der im Mythos ein Spielball der Götter war, wurde im christlichen Glauben zum verantwortlichen Subjekt, das sein Leben führen muss.
Und als ihm die Pfaffen als Wegweiser suspekt wurden, musste ‘die Natur’ herhalten. Die Natur durchherrscht vom Logos, der Mensch ein Teil der Natur, seine Vernunft ihr ureigenes Gesetz – das ist der Sinn der Metaphysik. Ratio – reason, raison – heißt Rechnung. Dieser ‘Sinn des Lebens’, des bürgerlichen Erwerbslebens, war im Voraus längst “gefunden”, die Philosophie musste ihn nur noch absegnen.
Die Gleichsetzung von Sinn und Sein gehört zu den naiven Selbstverständlichkeiten unseres Denkens. Sie liegt vor aller Reflexion, aller Überlegung, aller… Vernunft. Sie entstammt der kindlichen Annahme, dass das, was da ist, da sein muss; dass das, was in der Wirklichkeit geschieht, mit Notwendigkeit geschieht. Sich gegen das Notwendige stellen ist sinnlos.
Sinn ‘gibt es’ nicht an und für sich. Es muss immer einer da sein, für den irgendwas Sinn hat oder nicht. Und was kann das heißen: es hat für ihn Sinn? Es heißt, dass irgendeine Entscheidung, die er zu treffen hat, davon abhängt. Worüber kann ich entscheiden? Über das, was ich bin? Nein, über das, was ich tue. Für mich hat all das Sinn, was ich bei meinen Handlungsentscheidungen bedenken muss. Die Frage nach dem Sinn geht von den lebenden Subjekten aus. Bevor wir sie den Dingen stellen, müssen wir sie uns selber stellen. ‘Ich bin ein Teil der Natur und unterliege ihrem Gesetz’ ist eine Antwort, bevor die Frage gestellt wurde. Sie könnte falsch sein.
Die Gleichsetzung von Sein und Sinn ist dasselbe wie die Gleichsetzung von Logik und Naturgeschehen. Ihr gemeinsames Drittes ist die “Notwendigkeit”.
Und als ihm die Pfaffen als Wegweiser suspekt wurden, musste ‘die Natur’ herhalten. Die Natur durchherrscht vom Logos, der Mensch ein Teil der Natur, seine Vernunft ihr ureigenes Gesetz – das ist der Sinn der Metaphysik. Ratio – reason, raison – heißt Rechnung. Dieser ‘Sinn des Lebens’, des bürgerlichen Erwerbslebens, war im Voraus längst “gefunden”, die Philosophie musste ihn nur noch absegnen.
Die Gleichsetzung von Sinn und Sein gehört zu den naiven Selbstverständlichkeiten unseres Denkens. Sie liegt vor aller Reflexion, aller Überlegung, aller… Vernunft. Sie entstammt der kindlichen Annahme, dass das, was da ist, da sein muss; dass das, was in der Wirklichkeit geschieht, mit Notwendigkeit geschieht. Sich gegen das Notwendige stellen ist sinnlos.
Sinn ‘gibt es’ nicht an und für sich. Es muss immer einer da sein, für den irgendwas Sinn hat oder nicht. Und was kann das heißen: es hat für ihn Sinn? Es heißt, dass irgendeine Entscheidung, die er zu treffen hat, davon abhängt. Worüber kann ich entscheiden? Über das, was ich bin? Nein, über das, was ich tue. Für mich hat all das Sinn, was ich bei meinen Handlungsentscheidungen bedenken muss. Die Frage nach dem Sinn geht von den lebenden Subjekten aus. Bevor wir sie den Dingen stellen, müssen wir sie uns selber stellen. ‘Ich bin ein Teil der Natur und unterliege ihrem Gesetz’ ist eine Antwort, bevor die Frage gestellt wurde. Sie könnte falsch sein.
Die Gleichsetzung von Sein und Sinn ist dasselbe wie die Gleichsetzung von Logik und Naturgeschehen. Ihr gemeinsames Drittes ist die “Notwendigkeit”.
 Tatsächlich
stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der
Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen
Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,
nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.
Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir
per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur
annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus
einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht
beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.
Tatsächlich
stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der
Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen
Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,
nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.
Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir
per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur
annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus
einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht
beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.VIII: Kausalität, oder Der Mythos vom Allverursacher
Die
Logisierung, nämlich Mathematisierung der Welt durch Descartes und
Newton im 17. Jahrhundert gilt als der Sieg der Vernunft über den
Mythos. Wissenschaftlich und rational ist seither nur jene
Weltbetrachtung, die alles Sicht- wie alles Denkbare unter die Kategorie
von Ursache und Wirkung fasst. Dabei ist das selber ein Mythos, wenn
auch einer von höherer Ordnung. Die alten Mythen erzählten – anders als
die Wissenschaft, die in allgemeinen Sätzen spricht – immer von
besonderen Ereignissen, die sinnbildlich auf Mehr deuten. Dieser moderne
Metamythos handelt aber von Allem und Jedem.
Spinoza hat ihn zum mechanischen Universalsystem ausgetüftelt: Der Erste Verursacher – deus sive natura – konstruiert sich ordine geometrico zur Welt. Da hat die Kausalität keine Lücke – Determiniertheit aller Orten. Die Willensfreiheit war auch für ihn das große Skandalon. “Die Menschen täuschen sich darin, dass sie glauben, sie seien frei. Diese Meinung besteht bloß darin, dass sie sich ihrer Handlungen bewusst sind, die Ursachen aber, wovon sie bestimmt werden, nicht kennen. Das also ist die Idee ihrer Freiheit, das sie keine Ursache ihrer Handlungen kennen. Denn wenn sie sagen, die menschlichen Handlungen hängen vom Willen ab, so sind das Worte, von welchen sie keine Idee haben. Was der Wille ist und wie er den Körper bewegt, wissen sie ja alle nicht, und diejenigen, die etwas anderes vorgeben und einen Sitz und Aufenthalt der Seele erdichten, erregen damit nur Lachen und Verdruss.” (Substanziell mehr haben die Hirnphysiologen unserer Tage in dieser Sache auch nicht vorgebracht.)
Wenn ich mich einmal entschlossen habe, den Fluss des wirklichen Geschehens in eine zeitliche Folge von Zuständen aufzulösen, und ferner entschlossen bin, das Nacheinander der Zustände als ein Machen aufzufassen, dann werde ich, was Wunder, allenthalben Ursachen und deren Folgen antreffen. Aber aus welchem Rechtsgrund durfte ich so verfahren? “Wir wissen mit mehr Deutlichkeit, dass unser Wille frei ist, als dass alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse”, sagt Lichtenberg; könne man also nicht das Argument umkehren und sagen: Unsre Begriffe von Ursache und Wirkung “müssen sehr unrichtig sein”, weil unser Wille sonst nicht frei sein könnte?
Sein älterer Zeitgenosse David Hume hatte die Idee der Kausalität bereits zwar nicht für unrichtig, aber doch für rational unhaltbar erklärt. Die Vorstellung, dass das, was post hoc – nach-jetzt – geschieht, propter hoc geschähe: wegen-jetzt, sei eine bloße Gewohnheit der alltäglichen Anschauung ohne jeden vernünftigen Grund. Noch kein Mensch hat sich bei dem Satz, dass Etwas ist, “weil” etwas Anderes vorher war, je wirklich etwas denken können – es sei denn, er hat sich einen Macher hinzugedacht.
Als Descartes und Newton seinerzeit die moderne, wissenschaftliche Weltanschauung begründeten, haben sie das nicht verhohlen: In ihrer mathematisierten ‚Natur’ wurde die Kausalität durch “wirkende Kräfte” gewährleistet, die der Schöpfer ihr eingepflanzt hatte; mechanische Kräfte: Druck und Stoß. Als etwa Newton ins Weltall die “Anziehungskraft” einführte, fehlte ihm im leeren Raum ein Medium, durch welches sie ‚übertragen’ werden konnte; also wurde gleich der ‚Äther’ mit hinzu erfunden! Im folgenden Jahrhundert obsiegten dann die Empiriker. Wirkende Kräfte waren experimentell nicht nachzuweisen. Auf den Sensualisten Locke folgte der Skeptiker Hume.
Alles hat seine Zeit, seit den Revolutionen der Thermodynamik ist Newtons Physik überholt, und in Einsteins Universum ist an wirkende Kräfte schon gar nicht mehr zu denken. Wer heute in der Wissenschaft die Kausalität nicht heuristisch-regulativ, sondern als Begründung verwenden will, muss sich seinen Macher klammheimlich hinzudenken. Wer etwas anderes vorgibt, erregt… Lachen und Verdruss.
Denn natürlich ist der Satz, dass nichts ohne zureichende Ursache geschieht, viel älter als Newton und alle Wissenschaft. “Ich bemerke etwas und suche nach einem Grund dafür, das heißt ursprünglich: Ich suche nach einer Absicht darin und vor allem nach einem, der Absicht hat, nach einem Subjekt, einem Täter: alles Geschehen ein Tun – ehemals sah man in allem Geschehen Absichten, dies ist unsere älteste Gewohnheit. Die Frage ‚warum?’ ist immer die Frage nach der Causa finalis, nach einem ‚Wozu?’ Was uns die Festigkeit des Glaubens an Kausalität gibt, ist nicht unsere Gewohnheit des Hintereinander von Vorgängen, sondern unsere Unfähigkeit, ein Geschehen anders interpretieren zu können als ein Geschehen aus Absichten. Es ist der Glaube, dass alles Geschehen ein Tun sei, dass alles Tun einen Täter voraussetzt”, sagt Nietzsche.
Und Georg von Wright pflichtet bei, “dass die Unterscheidung zwischen Ursache- und Wirkungs-Faktoren auf die Unterscheidung zwischen Dingen, die getan werden, und Dingen, die durch eine Handlung herbeigeführt werden, zurückgeht. Eine Relation zwischen Ereignissen als kausal ansehen heißt, sie unter dem Aspekt einer (möglichen) Handlung ansehen”.
Das führt uns zu folgender Schwindel erregenden Konsequenz: “Der populäre Glaube an Ursache und Wirkung ist auf die Voraussetzung gebaut, dass der freie Wille Ursache sei von jeder Wirkung. Erst daher haben wir das Gefühl der Kausalität.” Allerdings ist es nicht der freie Wille von dir und mir, sondern der freie Wille des Welturhebers.
Wenn alles seine Ursache hat, dann muss am Anfang der Kette eine Erste Ursache stehen. Mit der Kausalität glaubten die Menschen, den Urheber bei der Arbeit belauscht zu haben: Die Natur hat einen “Plan”. Nichts tut sie ohne Bedacht. Und vergeudet nichts! Die Kausalität ist eine säkulare Theologie. Sie gehört zum Bild von der Natur als einem Haushälter. Sie ist die Apotheose der bürgerlichen Gesellschaft.
Spinoza hat ihn zum mechanischen Universalsystem ausgetüftelt: Der Erste Verursacher – deus sive natura – konstruiert sich ordine geometrico zur Welt. Da hat die Kausalität keine Lücke – Determiniertheit aller Orten. Die Willensfreiheit war auch für ihn das große Skandalon. “Die Menschen täuschen sich darin, dass sie glauben, sie seien frei. Diese Meinung besteht bloß darin, dass sie sich ihrer Handlungen bewusst sind, die Ursachen aber, wovon sie bestimmt werden, nicht kennen. Das also ist die Idee ihrer Freiheit, das sie keine Ursache ihrer Handlungen kennen. Denn wenn sie sagen, die menschlichen Handlungen hängen vom Willen ab, so sind das Worte, von welchen sie keine Idee haben. Was der Wille ist und wie er den Körper bewegt, wissen sie ja alle nicht, und diejenigen, die etwas anderes vorgeben und einen Sitz und Aufenthalt der Seele erdichten, erregen damit nur Lachen und Verdruss.” (Substanziell mehr haben die Hirnphysiologen unserer Tage in dieser Sache auch nicht vorgebracht.)
Wenn ich mich einmal entschlossen habe, den Fluss des wirklichen Geschehens in eine zeitliche Folge von Zuständen aufzulösen, und ferner entschlossen bin, das Nacheinander der Zustände als ein Machen aufzufassen, dann werde ich, was Wunder, allenthalben Ursachen und deren Folgen antreffen. Aber aus welchem Rechtsgrund durfte ich so verfahren? “Wir wissen mit mehr Deutlichkeit, dass unser Wille frei ist, als dass alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse”, sagt Lichtenberg; könne man also nicht das Argument umkehren und sagen: Unsre Begriffe von Ursache und Wirkung “müssen sehr unrichtig sein”, weil unser Wille sonst nicht frei sein könnte?
Sein älterer Zeitgenosse David Hume hatte die Idee der Kausalität bereits zwar nicht für unrichtig, aber doch für rational unhaltbar erklärt. Die Vorstellung, dass das, was post hoc – nach-jetzt – geschieht, propter hoc geschähe: wegen-jetzt, sei eine bloße Gewohnheit der alltäglichen Anschauung ohne jeden vernünftigen Grund. Noch kein Mensch hat sich bei dem Satz, dass Etwas ist, “weil” etwas Anderes vorher war, je wirklich etwas denken können – es sei denn, er hat sich einen Macher hinzugedacht.
Als Descartes und Newton seinerzeit die moderne, wissenschaftliche Weltanschauung begründeten, haben sie das nicht verhohlen: In ihrer mathematisierten ‚Natur’ wurde die Kausalität durch “wirkende Kräfte” gewährleistet, die der Schöpfer ihr eingepflanzt hatte; mechanische Kräfte: Druck und Stoß. Als etwa Newton ins Weltall die “Anziehungskraft” einführte, fehlte ihm im leeren Raum ein Medium, durch welches sie ‚übertragen’ werden konnte; also wurde gleich der ‚Äther’ mit hinzu erfunden! Im folgenden Jahrhundert obsiegten dann die Empiriker. Wirkende Kräfte waren experimentell nicht nachzuweisen. Auf den Sensualisten Locke folgte der Skeptiker Hume.
Alles hat seine Zeit, seit den Revolutionen der Thermodynamik ist Newtons Physik überholt, und in Einsteins Universum ist an wirkende Kräfte schon gar nicht mehr zu denken. Wer heute in der Wissenschaft die Kausalität nicht heuristisch-regulativ, sondern als Begründung verwenden will, muss sich seinen Macher klammheimlich hinzudenken. Wer etwas anderes vorgibt, erregt… Lachen und Verdruss.
Denn natürlich ist der Satz, dass nichts ohne zureichende Ursache geschieht, viel älter als Newton und alle Wissenschaft. “Ich bemerke etwas und suche nach einem Grund dafür, das heißt ursprünglich: Ich suche nach einer Absicht darin und vor allem nach einem, der Absicht hat, nach einem Subjekt, einem Täter: alles Geschehen ein Tun – ehemals sah man in allem Geschehen Absichten, dies ist unsere älteste Gewohnheit. Die Frage ‚warum?’ ist immer die Frage nach der Causa finalis, nach einem ‚Wozu?’ Was uns die Festigkeit des Glaubens an Kausalität gibt, ist nicht unsere Gewohnheit des Hintereinander von Vorgängen, sondern unsere Unfähigkeit, ein Geschehen anders interpretieren zu können als ein Geschehen aus Absichten. Es ist der Glaube, dass alles Geschehen ein Tun sei, dass alles Tun einen Täter voraussetzt”, sagt Nietzsche.
Und Georg von Wright pflichtet bei, “dass die Unterscheidung zwischen Ursache- und Wirkungs-Faktoren auf die Unterscheidung zwischen Dingen, die getan werden, und Dingen, die durch eine Handlung herbeigeführt werden, zurückgeht. Eine Relation zwischen Ereignissen als kausal ansehen heißt, sie unter dem Aspekt einer (möglichen) Handlung ansehen”.
Das führt uns zu folgender Schwindel erregenden Konsequenz: “Der populäre Glaube an Ursache und Wirkung ist auf die Voraussetzung gebaut, dass der freie Wille Ursache sei von jeder Wirkung. Erst daher haben wir das Gefühl der Kausalität.” Allerdings ist es nicht der freie Wille von dir und mir, sondern der freie Wille des Welturhebers.
Wenn alles seine Ursache hat, dann muss am Anfang der Kette eine Erste Ursache stehen. Mit der Kausalität glaubten die Menschen, den Urheber bei der Arbeit belauscht zu haben: Die Natur hat einen “Plan”. Nichts tut sie ohne Bedacht. Und vergeudet nichts! Die Kausalität ist eine säkulare Theologie. Sie gehört zum Bild von der Natur als einem Haushälter. Sie ist die Apotheose der bürgerlichen Gesellschaft.
IX. Aus der Nische in die Welt, oder: Warum die Menschen aufrecht gehen

Leben
ist für die Wissenschaft gleich Stoffwechsel plus Fortpflanzung.
Allein, der Mensch kann sich unter allen Kreaturen nicht damit begnügen.
Weil er nicht mehr in einer geschlossenen Umwelt zu Hause ist, die ihm
seine Bestimmung vorgibt, sondern in einer offenen Welt, wo er sein
Leben führen muss – und das ist ein Problem. Nur weil er es hat, sagt er
“ich”. Es ist die Conditio humana selbst und liegt offenbar jenseits
der Naturwissenschaft.
Die Welt ist nicht ‚alles, was der Fall ist’. Sie ist ein Tableau von Bedeutungen, die von den Generationen, die vor uns waren, festgehalten und zu einem “Symbolnetz” (Ernst Cassirer) geknüpft wurden. Darum nehmen wir gar keine ‘Dinge’ wahr, sondern immer nur ‘das, was sie bedeuten’. Die Abstraktion davon: die Frage nach dem Ding, wie es ‘an sich ist’, gehört nicht zum natürlichen Bewusstsein, sondern schon zur Wissenschaft. Die Welt ist gattungsgeschichtlich definiert als der Raum, in den ich fragend blicke: ob sie mir einen Anhalts- punkt gibt für meine Lebensführung? Ich rechne vorab auf eine Bedeutung, und daher treffe ich meistens eine an.
Die Welt ist nicht ‚alles, was der Fall ist’. Sie ist ein Tableau von Bedeutungen, die von den Generationen, die vor uns waren, festgehalten und zu einem “Symbolnetz” (Ernst Cassirer) geknüpft wurden. Darum nehmen wir gar keine ‘Dinge’ wahr, sondern immer nur ‘das, was sie bedeuten’. Die Abstraktion davon: die Frage nach dem Ding, wie es ‘an sich ist’, gehört nicht zum natürlichen Bewusstsein, sondern schon zur Wissenschaft. Die Welt ist gattungsgeschichtlich definiert als der Raum, in den ich fragend blicke: ob sie mir einen Anhalts- punkt gibt für meine Lebensführung? Ich rechne vorab auf eine Bedeutung, und daher treffe ich meistens eine an.
Das ist eine Dimension, die sich der Mensch selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Doch auch das Tier lebt nicht in einer Welt, die ‘der Fall ist’, sondern in Bedeutungen. Evolution ist Auslese und Anpassung. Im Laufe ihrer Geschichte hat jede Spezies ihre ökologische Nische gefunden und hat sie zu ihrer Umwelt eingerichtet. Jede tierische Umwelt bildet nach Jakob von Uexküll, dem Begründer des biologischen Umwelt-Begriffs, “eine in sich geschlossene Einheit, die in all ihren Teilen durch die Bedeutung für das Subjekt beherrscht wird. Alles und jedes, das in den Bann einer Umwelt gerät, wird umgestimmt und umgeformt, bis es zu einem brauchbaren Bedeutungsträger geworden ist – oder es wird völlig vernachlässigt.”
Was die Dinge seiner Umwelt dem Tier bedeuten, “versteht sich von selbst” – da muss es das Tier nicht auch noch verstehen. Die Gattung und ihre Umwelt sind gewissermaßen durch Vererbung miteinander verwandt. Dem Menschen werden die Bedeutungen der Dinge durch Symbole mitgeteilt, die ihm von andern Menschen überliefert wurden: Deren Bedeutungen muss er jedesmal wieder selber realisieren, nämlich verstehen.
Die
Bedeutungen tierischer Umwelten haben freilich einen gemeinsamen
Nenner: Sie sind Funktionen der Erhaltung – der Individuen wie der Art.
Was keinen Erhaltungswert hat, kommt in ihnen, wenn es auch ‘da’ ist,
buchstäblich nicht vor. Der Mensch hat vor Jahrmillionen seine Urwaldnische
verlassen und ist aus der ererbten Umwelt in eine fremde Welt
aufgebrochen. Deren Bedeu- tungen waren nicht ererbt; er mußte sie
selber heraus-, d. h. hineinfinden: Ihm kann alles bedeutsam werden. Und
die Bedeutung ist, seit er einmal dem Überfluß begegnet war, nicht mehr
auf den Erhaltungswert beschränkt: Jedes kann ihm Vieles bedeuten,
und er kann sich sogar selber fraglich werden. Bedeutung: das ist
dasjenige ‘an’ den Dingen, das zum Bestimmungsgrund für mein Handeln
werden könnte; mich veranlassen kann, mein Leben so oder anders zu
führen. Die Bedeutung eines Dinges feststellen heißt urteilen. “Der
Mensch muß urteilen” und “der Mensch muß handeln” bedeuten dasselbe.
Handeln heißt nicht bloß ‚etwas tun’ (das tut das Tier auch), sondern:
einen Grund dafür haben.
Natürlich kann der Erhaltungswert einer Sache für mich zu einem Urteilsgrund werden. Aber er muss nicht. Der Mensch kann Nein sagen. Kritik, wie Krisis, kommt von gr. krínein, entscheiden. Der Mensch ist das kritische Tier, das Wesen, das allezeit urteilt, weil es sich stets entscheiden muss. Die Erscheinungen, zu denen er -, die Situationen, in denen er Ja oder Nein sagen muß, erheischen Maßstäbe: Bedeutungen, unter sie er sie fassen kann.
Die hat er im Laufe seiner Geschichte in Symbolen fixiert und in ein Repertoire gefügt, wo sie ihm vorrätig sind. Jetzt sieht es so aus, als seien die Bedeutungen vor den Dingen da. Die symbolische Form verleiht ihnen einen Anschein von Dauer und Wahrheit, die ihnen doch nur zukommen, wenn und inwiefern sie in realen Situationen je aktualisiert werden: im handelnden Urteil. Und dann ist es “so, als ob” er sie jedesmal neu erfunden hätte. Denn er hätte, wohlgemerkt, auch Nein sagen können.
Natürliche Umwelten sind geschlossen, aber eine Welt ist offen; jene sind begrenzt, aber sie ist unendlich, denn ihre Grenzen finden ihre Bedeutung erst durch das, was dahinter liegt; jene sind vertraut, aber sie ist fremd und bunt; jene sind sicher, aber sie ist Lockung und Gefahr zugleich. Sie ist überhaupt keine “Gegend”, sondern bloß ihr Horizont.
Wie ist er dahin gelangt? Durch seinen aufrechten Gang. Als er nämlich seine herkömmliche Nische auf den Bäumen verließ, nein: als vielmehr der Klimawandel im ostafrika- nischen Graben den Regenwald in eine feuchte Parksavanne zersetzte. Während einige unserer Vorfahren sich mit dem angestammten Urwald zurückzogen, vielleicht überlegenen Konkurrenten weichend – da wagte er sich ins offene Feld hinaus, wo er Überblick brauchte und größere Behendigkeit, denn jene Savanne war nicht eine Nische, sondern ein unzusammenhängender Flickenteppich aus vielen verschiedenen Lebensräumen, zwischen denen er seither ständig unterwegs ist. Spezialisierung auf einen unspezifischen Lebensraum heißt aber Entspezialisierung. Er wurde zum Ausreißer, zum Vaganten. Der Normalzustand, für den er sich zurichten mußte, war der Wechsel. Er entschied sich fürs Ungewisse.
Mit dem Ausbruch in die Welt ist der Mensch über die Naturgeschichte hinaus in seine eigene Geschichte eingetreten. Nicht, dass seine Naturgeschichte damit abgeschlossen wäre – sie ging überhaupt erst richtig los. Aber auch sie macht er seither selber.
Natürlich kann der Erhaltungswert einer Sache für mich zu einem Urteilsgrund werden. Aber er muss nicht. Der Mensch kann Nein sagen. Kritik, wie Krisis, kommt von gr. krínein, entscheiden. Der Mensch ist das kritische Tier, das Wesen, das allezeit urteilt, weil es sich stets entscheiden muss. Die Erscheinungen, zu denen er -, die Situationen, in denen er Ja oder Nein sagen muß, erheischen Maßstäbe: Bedeutungen, unter sie er sie fassen kann.
Die hat er im Laufe seiner Geschichte in Symbolen fixiert und in ein Repertoire gefügt, wo sie ihm vorrätig sind. Jetzt sieht es so aus, als seien die Bedeutungen vor den Dingen da. Die symbolische Form verleiht ihnen einen Anschein von Dauer und Wahrheit, die ihnen doch nur zukommen, wenn und inwiefern sie in realen Situationen je aktualisiert werden: im handelnden Urteil. Und dann ist es “so, als ob” er sie jedesmal neu erfunden hätte. Denn er hätte, wohlgemerkt, auch Nein sagen können.
Natürliche Umwelten sind geschlossen, aber eine Welt ist offen; jene sind begrenzt, aber sie ist unendlich, denn ihre Grenzen finden ihre Bedeutung erst durch das, was dahinter liegt; jene sind vertraut, aber sie ist fremd und bunt; jene sind sicher, aber sie ist Lockung und Gefahr zugleich. Sie ist überhaupt keine “Gegend”, sondern bloß ihr Horizont.
Wie ist er dahin gelangt? Durch seinen aufrechten Gang. Als er nämlich seine herkömmliche Nische auf den Bäumen verließ, nein: als vielmehr der Klimawandel im ostafrika- nischen Graben den Regenwald in eine feuchte Parksavanne zersetzte. Während einige unserer Vorfahren sich mit dem angestammten Urwald zurückzogen, vielleicht überlegenen Konkurrenten weichend – da wagte er sich ins offene Feld hinaus, wo er Überblick brauchte und größere Behendigkeit, denn jene Savanne war nicht eine Nische, sondern ein unzusammenhängender Flickenteppich aus vielen verschiedenen Lebensräumen, zwischen denen er seither ständig unterwegs ist. Spezialisierung auf einen unspezifischen Lebensraum heißt aber Entspezialisierung. Er wurde zum Ausreißer, zum Vaganten. Der Normalzustand, für den er sich zurichten mußte, war der Wechsel. Er entschied sich fürs Ungewisse.
Mit dem Ausbruch in die Welt ist der Mensch über die Naturgeschichte hinaus in seine eigene Geschichte eingetreten. Nicht, dass seine Naturgeschichte damit abgeschlossen wäre – sie ging überhaupt erst richtig los. Aber auch sie macht er seither selber.
XI: Der Sündenfall, oder: Arbeit ist der Sinn des Lebens
Wahr
ist, dass sich im Lauf der letzten Jahrtausende das Symbolnetz, das
unsere Welt bedeutet, um eine Art Knoten geschürzt hat, der den
Bedeutungen allen dieselbe Tendenz, dieselbe Fallrichtung  mitgeteilt
hat; um einen ‘Erhaltungswert höherer Ordnung’, alias ökonomischer
Nutzen: den Tauschwert. Der hat alle andern Werte eingefärbt: ein
Resultat der Arbeitsgesellschaft – ihrerseits eine Nische höherer
Ordnung.
mitgeteilt
hat; um einen ‘Erhaltungswert höherer Ordnung’, alias ökonomischer
Nutzen: den Tauschwert. Der hat alle andern Werte eingefärbt: ein
Resultat der Arbeitsgesellschaft – ihrerseits eine Nische höherer
Ordnung.
 mitgeteilt
hat; um einen ‘Erhaltungswert höherer Ordnung’, alias ökonomischer
Nutzen: den Tauschwert. Der hat alle andern Werte eingefärbt: ein
Resultat der Arbeitsgesellschaft – ihrerseits eine Nische höherer
Ordnung.
mitgeteilt
hat; um einen ‘Erhaltungswert höherer Ordnung’, alias ökonomischer
Nutzen: den Tauschwert. Der hat alle andern Werte eingefärbt: ein
Resultat der Arbeitsgesellschaft – ihrerseits eine Nische höherer
Ordnung.
Als sie ihren Urwald verlassen hatten, lebten die ersten Menschen auf ihre Art, als Jäger und Sammler, “mit der Natur in Einklang”. Sie behandelten die Naturdinge als ihresgleichen, als beseelt und mit Willen begabt.
Die erste Welt, die frühesten Symbole waren animistisch. Diese Art
Sinngebung hat einen unübersehbar luxuriösen Zug: In der
altsteinzeitlichen Kunst von Lascaux und Altamira kann man ihn sich
anschauen.
Das
Wanderleben war allerdings gefährlich: Bedeutend wurde Sicherung. Die
einzige Sicherheit bot der soziale Zusammenhalt – die Blutsbande. Das
Totem prägt die ursprünglichen Symboliken. Und weit bis in die
Ackerbaugesellschaften beruhen die politischen Strukturen auf Verwandtschaftsbeziehungen; Athen und Rom etwa auf phyle und gens. Das
Blut und der Boden sind der Grund von Wert und Sinn, in den antiken
Mythologien streiten sich Erd- und Himmelsgötter wie die Bauern- und
Hirtenvölker in der Wirklichkeit. Doch schließlich beherrscht die Arbeit
die alltäglichen Urteile, durch Handel und Geldverkehr rückt das
Abstraktum ‘Wert’ an die Stelle anschaulicher Qualitäten.
 Am
Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen
Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und
dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.
Das war die Erfindung des Ackerbaus vor
vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung
der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er
funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden
muß.
Am
Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen
Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und
dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.
Das war die Erfindung des Ackerbaus vor
vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung
der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er
funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden
muß.
Die
vollendete, ‘ausgebildete’ Form der Arbeitsgesellschaft ist die
Marktwirtschaft: Alles hat seinen Preis. Jetzt müssen die Arbeiten
gegeneinander austauschbar, ihre Qualität muss mess- und vergleichbar
sein. Die Nützlichkeit der einen Sache muß sich in der Nützlichkeit der
andern Sache darstellen lassen. An die Stelle der Gebrauchswerte tritt der Tauschwert, der ‘Wert’ der Nationalökonomen: eine Art Nützlichkeit-an-sich.
Das ist die Logik der Arbeitsteilung: die Reduktion der Qualitäten auf komplex zusammengesetzte Quantitäten; das Absehen von der Stoff- und das Hervorkehren der Formseite; die Auflösung einer jeden Substanz in ihr Herstellungsverfahren; die Reduktion der Sache auf die Mache. Wir reden von “Tat”sachen, und wenn wir ihre
 ‘qualitas’ meinen, sagen wir
“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”
zurück führen.
‘qualitas’ meinen, sagen wir
“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”
zurück führen.
Diese
fabrizierte Umweltnische hat gegenüber den natürlichen eine Eigenart:
Sie dehnt sich aus. Und bleibt dabei doch, wie sie ist! Alles ist
gemacht. Und alles ist Material. Seit die Welt Material wurde, ist sie
planbar. Seit durch die Arbeit das Leben nicht bloß Ereignis, sondernPlan geworden ist, wird die Welt zum Vorratslager.
Und
zu einem Reich von Ursachen und Folgen. Man wird sie vermessen und
kartieren wollen. Auch die Logik, als Ökonomie des Denkens, entstammt
den vorsorglichen Plänen der Arbeitsgesellschaft.
XIII. Unsere Welt und die meine

Alles, was als
Tatsache in unserer Welt vorkommt, lässt sich auch bestimmen; nämlich
in das allgemeine Bedeutungsgeflecht einpassen, wo Jedem seine Bedeutung
durch die Bedeutung aller Andern zugewiesen wird. Reflektieren heißt
nichts anderes als: seinen Platz im großen Verweisungszusammenhang
aufsuchen.
Was
bestimmt ist, kann Bestandteil einer Wissenschaft werden – weil sich
sein logischer Zusammenhang demonstrieren und Einverständnis erzwingen
lässt. Was demonstriert werden kann, lässt sich erlernen. Was dagegen
‘durch meine Freiheit möglich’ wurde, läßt sich eo ipso nicht bestimmen.
Es liegt allein in meiner Welt. Ich kann es nicht erlernen, sondern
muss es erfinden und mir ein-bilden. Einverständnis der andern kann ich
nicht erzwingen, sondern höchstens ihren Beifall heischen: sie
animieren, meine ‘Anschauung’ nach-zu-erfinden.
Das
Nacherfinden kann nicht gelehrt werden: dazu muss man verführen, und
das ist Kunst. Gegenstand von Wissenschaft kann es nur idiographisch
werden: kritisch und historisch.
Erziehen heißt nun,
einem Menschen die Dinge zeigen und die Symbole, die ihm die Welt
bedeuten. Doch haben die in den Symbolen aufbewahrten Bedeutungen einen
andern Realitätsgrad als die Dinge. Sie ’sind’ ja nur, sofern ich sie
gelten lasse. Denn der Mensch ist das Tier, das nein sagen kann (Max
Scheler); auch dazu: den Meinungen der Andern. Fragen können heißt, ja
oder nein sagen können.
‘Die Welt’ wird zwar überliefert, aber seine Welt bildet sich jeder selbst.
Meiner Welt liegt unsere Welt gewissermaßen zu Grunde. Und unserer Welt
liegt meine Welt zu Grunde. Das einemal kategorisch, das andermal
genetisch. Dass ich überhaupt darauf komme, die Daten, die mir meine
Sinne melden, zu einer “Welt” zu konstruieren, liegt allein daran, dass
ich in die Welt der Andern hineingeboren bin.
 Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,
dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich
sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt
an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen
Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!
Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,
dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich
sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt
an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen
Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!
“Ich” konstruiere
eine Welt. Es wird meine Welt sein: Darum bin ich Ich. Und in dem Maße,
wie ich hernach meine Welt mit der Welt der Andern ins Benehmen setze,
werde ich Verstand beweisen, Ernst des Lebens, Sozialkompetenz und so
weiter. Wie weit ich die eine von der andern durchdringen lasse,
entscheidet darüber, wohin ich mein Leben führen kann und wo ich
scheitern muß.
XIV: Ein erster, letzter Grund oder: Der schöne Schein des Wahren

Ursprung und Angelpunkt des abendländischen Denkens war die Frage nach dem Wahren. In der Sinnenwelt ist alles Trug. Sie scheint mal so, mal so, je nach Standort. Alles, was wird, wird vergehen. Wahr ist, was währt, das ewige Sein; doch es liegt unterm Werden verhüllt. Nur dem Denken ist es kenntlich, „denn dasselbe ist Denken und Sein“, sagt Parmenides. Die Frage nach dem wahren Sein ist die Frage, wonach sich mein Leben in der Mannigfaltigkeit trügerischer Erscheinungen richten soll.
Man erkennt es beim Vergleich mit Heraklit, gegen den Parmenides angetreten war: Nicht zweimal könne man in einen Fluss steigen; der Fluss sei ein anderer geworden und der Mensch auch. Hinter dem Werden ist Nichts, wahr ist der Schein: Das möchte man einen heroischen Nihilismus nennen; ein aristokratisches Leben auf eigne Faust, das sich nicht jeder leisten kann. Die Vermutung, daß der Sinn der Welt zwar verborgen, aber jedenfalls in ihr liegt, macht dagegen auch kleinen Leuten Mut. Nicht anders konnte die Arbeitsgesellschaft siegen, nicht anders konnte Europa die Welt erobern.
Die Erkenntnis, dass nach dem Sinn gefragt werden muss, war die
Geburtsstunde des Abendlands.
Der ebenbürtige Zeitgenosse von Heraklit und Parmenides war Aischylos – der als erster die Schuld der Menschen zum Thema gemacht hat; nämlich dass sie ihre Wege selber wählen. Es wurde zum Thema der westlichen Kultur. Man mag auch meinen, es sei die Conditio humana selbst. Nur wurde sie nicht überall ihrer bewusst.
Das Wahre, das Ansich-Seiende, das Absolute; Wert, Bedeutung, Geltung, Sinn – das alles sind verschiedene Worte für ein Problem. Nämlich dies, dass der Mensch sich nicht mit dem Leben begnügen kann, sondern immer sein Leben führen muss. Führen wo hin, wo lang? Er muss sich orientieren. Das, woran er sich orientiert hat, um dessentwillen er gelebt hat, nennt er, rückblickend, ‚’das Wahre’, ‘das Absolute’, den ‘Sinn’. Das Erkennen ist zirkulär.
Warum? Es kommt a posteriori. Denn gesetzt wird der Sinn immer ‘in actu’, hier und jetzt, an jedem Wegkreuz neu. Dem (nachträglichen) Erkennen erscheint es darum als a priori. ‘Das Wahre’, ‘das Absolute’, der ‘Sinn’ ist – reell wie ideell – eben keine Sache, sondern ein Problem. Es ist aber keins, worauf die Menschen ebenso gut verzichten könnten. Sie waren tätig, bevor sie erkennend wurden. Aber sie müssen erkennend sein, um selbsttätig zu werden.
Nur weil der Mensch ein Leben führt, dessen Sinn weit über seine bloße Erhaltung hinaus reicht (wenn er es will), hat er das Problem der Freiheit. Ob er es will, ist damit noch nicht entschieden. Wenn einer sagt: Die Befriedigung meiner Bedürfnisse ist mir genug – wie kann ich ihm widersprechen? Es gibt noch viele, die sich mehr gar nicht leisten können.
Aber eine Kultur, wo verknappter Luxus schon wie Not erscheint, lebt im Überfluss. Dieses ist eine Sinnbehauptung: Es sollte eine Welt des Reichtums entstehen, damit Menschen in die Lage kommen, ihre Freiheit bestimmen zu können. Nur darum gibt es die Frage nach der Wahrheit. Aber die ist ein Paradox.
Was ich tun soll, ist eine Frage von Bedeutungen. Ist Sache eines Urteils. Und dafür brauche ich Gründe, die gelten. Deren Geltung muss ihrerseits begründet sein, und so fort. Machen wir’s kurz: Wenn überhaupt etwas gelten soll, muss es irgendwo einen Grund geben, der schlechterdings gilt und in letzter Instanz, ohne alle Bedingung – die Bedingungen von Ort und Zeit zumal. In der Welt, die ‘der Fall ist’, wird man ihn nicht antreffen. Er ist “nicht von dieser Welt“, ich muss ihn mir hinzu denken.
Der ebenbürtige Zeitgenosse von Heraklit und Parmenides war Aischylos – der als erster die Schuld der Menschen zum Thema gemacht hat; nämlich dass sie ihre Wege selber wählen. Es wurde zum Thema der westlichen Kultur. Man mag auch meinen, es sei die Conditio humana selbst. Nur wurde sie nicht überall ihrer bewusst.
Das Wahre, das Ansich-Seiende, das Absolute; Wert, Bedeutung, Geltung, Sinn – das alles sind verschiedene Worte für ein Problem. Nämlich dies, dass der Mensch sich nicht mit dem Leben begnügen kann, sondern immer sein Leben führen muss. Führen wo hin, wo lang? Er muss sich orientieren. Das, woran er sich orientiert hat, um dessentwillen er gelebt hat, nennt er, rückblickend, ‚’das Wahre’, ‘das Absolute’, den ‘Sinn’. Das Erkennen ist zirkulär.
Warum? Es kommt a posteriori. Denn gesetzt wird der Sinn immer ‘in actu’, hier und jetzt, an jedem Wegkreuz neu. Dem (nachträglichen) Erkennen erscheint es darum als a priori. ‘Das Wahre’, ‘das Absolute’, der ‘Sinn’ ist – reell wie ideell – eben keine Sache, sondern ein Problem. Es ist aber keins, worauf die Menschen ebenso gut verzichten könnten. Sie waren tätig, bevor sie erkennend wurden. Aber sie müssen erkennend sein, um selbsttätig zu werden.
Nur weil der Mensch ein Leben führt, dessen Sinn weit über seine bloße Erhaltung hinaus reicht (wenn er es will), hat er das Problem der Freiheit. Ob er es will, ist damit noch nicht entschieden. Wenn einer sagt: Die Befriedigung meiner Bedürfnisse ist mir genug – wie kann ich ihm widersprechen? Es gibt noch viele, die sich mehr gar nicht leisten können.
Aber eine Kultur, wo verknappter Luxus schon wie Not erscheint, lebt im Überfluss. Dieses ist eine Sinnbehauptung: Es sollte eine Welt des Reichtums entstehen, damit Menschen in die Lage kommen, ihre Freiheit bestimmen zu können. Nur darum gibt es die Frage nach der Wahrheit. Aber die ist ein Paradox.
Was ich tun soll, ist eine Frage von Bedeutungen. Ist Sache eines Urteils. Und dafür brauche ich Gründe, die gelten. Deren Geltung muss ihrerseits begründet sein, und so fort. Machen wir’s kurz: Wenn überhaupt etwas gelten soll, muss es irgendwo einen Grund geben, der schlechterdings gilt und in letzter Instanz, ohne alle Bedingung – die Bedingungen von Ort und Zeit zumal. In der Welt, die ‘der Fall ist’, wird man ihn nicht antreffen. Er ist “nicht von dieser Welt“, ich muss ihn mir hinzu denken.
 Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,
ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er
aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,
und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb
Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von
welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer
uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.
Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die
Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,
ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er
aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,
und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb
Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von
welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer
uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.
Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die
Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox. Das ist nicht bloß eine Idee. Das ist eine ästhetische Idee. Es ist, recht besehen, die ästhetische Idee schlechthin, die in alle tatsächlich vorkommenden Bestimmungen nach Ort und Zeit vorgängig hineingreift, die all die Qualitäten vereint, die ich an den Dingen “wertnehme”, bevor ich sie wahrnehme, und von der ich erst durch eine besondere Anstrengung des reflektierenden Verstandes wieder abstrahieren kann.
Es “ist” nicht so. Aber so muss ich es mir vorstellen, wenn ich mir überhaupt Etwas vorstellen will. Das Wissen kann seinen eignen Grund nicht erkennen. Es muss ihn sich ein-bilden. Der höchste Akt der Vernunft sei ein ästhetischer, hieß es im ‘Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus’. Ob er wirklich stattgefunden hat, ist nicht entscheidend. Es scheint uns so, als ob er stattgefunden hätte. Er ist so wahr wie ein Mythos sein kann. Will sagen, er muss sich bewähren.
Bewähren in Sonderheit in meinem täglichen Tun und Lassen – als Sittlichkeit. “Die Ethik ist transzendental“, schrieb Ludwig Wittgenstein, um gleich hinzu zu fügen: “Ethik und Ästhetik sind eins.” Und es sei klar, dass sie sich als solche “nicht aussprechen” lassen.
<
In den Wörtern unserer Welt lassen sie sich nicht aussprechen. Denn sie gehören zu meiner Welt. Den andern kann ich sie allenfalls zeigen – in den Bildern der Kunst. In Wörtern lässt sich das Problem immer nur so formulieren: Der Sinn des Lebens ist, dass du nach ihm fragst. Eben ein heroischer Nihilismus oder, wenn man will, “Artisten-Metaphysik”. Auf jeden Fall ist es eine romantische Anschauung der Welt, und eine fröhliche.

XV. Wozu noch philosophieren?
Und
das war alles – dass das Wahre ein Problem ist? Das wussten wir vorher.
Mehr hat die Philosophie nicht zu bieten? Keine Lösung?
Na ja – jetzt wissen wir es mit Gewissheit. Das ist ja auch schon was: Das Wahre ist kein Problem, das wir noch lösen werden, sondern eines, das bleibt. Nein, positiv ist die Philosophie nicht. Sie kommt zu keinen Ergebnissen, an die man sich halten kann – und nur ‘auf die Praxis anwenden’ muss. Sie ist keine Lehre, und darum kann man sie nicht lernen. Philosophieren kann man lernen; wenn man will.
Na ja – jetzt wissen wir es mit Gewissheit. Das ist ja auch schon was: Das Wahre ist kein Problem, das wir noch lösen werden, sondern eines, das bleibt. Nein, positiv ist die Philosophie nicht. Sie kommt zu keinen Ergebnissen, an die man sich halten kann – und nur ‘auf die Praxis anwenden’ muss. Sie ist keine Lehre, und darum kann man sie nicht lernen. Philosophieren kann man lernen; wenn man will.
Muss man wollen?
Man
kann nicht philosophieren, ohne zu leben, aber man kann leben, ohne zu
philosophieren, und womöglich bequemer. Allerdings ist das Zusammenleben
der Menschen darauf angewiesen, dass  nicht stets alle das Bequemere
wählen. Ein paar Leute, die philosophieren, werden immer gebraucht, und
so trifft es sich günstig, dass es immer ein paar Leute gibt, die das
Philosophieren brauchen.
nicht stets alle das Bequemere
wählen. Ein paar Leute, die philosophieren, werden immer gebraucht, und
so trifft es sich günstig, dass es immer ein paar Leute gibt, die das
Philosophieren brauchen.
Aber wozu?
Der Nutzen “ist negativ und kritisch”, sagt mein Gewährsmann. Wenn der Mensch etwas braucht, woran er sich halten kann, muss er bei sich selber suchen. Sie ist “kritisch und pädagogisch”, denn sie lehrt ihn – das doch! -, dass er es dort auch suchen soll. “Ihr Einfluss auf die Gesinnung des Menschengeschlechts überhaupt ist, dass sie ihnen Kraft, Mut und Selbstvertrauen beibringt, indem sie zeigt, dass sie und ihr ganzes Schicksal lediglich von sich selbst abhängen; indem sie den Menschen auf seine eignen Füße stellt.”
Welch tiefere Lebensweisheit es sonst noch geben soll, kann ich mir nicht vorstellen. Und welch gründlichere Pädagogik auch nicht.
 nicht stets alle das Bequemere
wählen. Ein paar Leute, die philosophieren, werden immer gebraucht, und
so trifft es sich günstig, dass es immer ein paar Leute gibt, die das
Philosophieren brauchen.
nicht stets alle das Bequemere
wählen. Ein paar Leute, die philosophieren, werden immer gebraucht, und
so trifft es sich günstig, dass es immer ein paar Leute gibt, die das
Philosophieren brauchen. Aber wozu?
Der Nutzen “ist negativ und kritisch”, sagt mein Gewährsmann. Wenn der Mensch etwas braucht, woran er sich halten kann, muss er bei sich selber suchen. Sie ist “kritisch und pädagogisch”, denn sie lehrt ihn – das doch! -, dass er es dort auch suchen soll. “Ihr Einfluss auf die Gesinnung des Menschengeschlechts überhaupt ist, dass sie ihnen Kraft, Mut und Selbstvertrauen beibringt, indem sie zeigt, dass sie und ihr ganzes Schicksal lediglich von sich selbst abhängen; indem sie den Menschen auf seine eignen Füße stellt.”
Welch tiefere Lebensweisheit es sonst noch geben soll, kann ich mir nicht vorstellen. Und welch gründlichere Pädagogik auch nicht.
abwärts
Mit meiner Wendeltreppe
wollte ich darstellen, wie das praktische Interesse der Menschen an
einem “rechten Leben” der Urheber für die theoretischen Betrachtungen
über den Sinn und die Beschaffenheit ihrer Welt wurde – und wie die daraus hervorgegangene Philosophie ihrerseits den Grund für die positiven Wissenschaften der Neuzeit gelegt hat.
Dabei war die Philosophie lange von ihrem Weg abgekommen. Wenn der Mensch als Teil eines sinnvoll geordneten Kosmos angesehen wird, dann wird wohl der Sinn jener Ordnung des Ganzen auch dessen Teile durchdringen, so musste es scheinen. Die umfassende Einsicht in die Gesetze der Natur würde mir die Stelle anweisen, wo ich hin gehöre; und wer und was ich bin, würde darüber bestimmen, was ich in der Welt soll. Meine Freiheit beschränkte sich dann auf meine Einsicht in die Notwendigkeiten.
Das kann dem Menschen nicht genügen, und darum fand er auch bald den Fehler darin: Er ist nicht nur Objekt der Naturgesetze, sondern auch Subjekt seines Wollens. Seine Freiheit in einer objektiven Welt von Zufällen und Notwendigkeiten mag nur eine ganz kleine sein; aber sie ist es, worauf es ihm ankommt.
Die Kritische oder Transzendentalphilosophie hat dem wissenschaftlichen Denken gezeigt, bis wo es reicht. Was wahr ist, kann sie nur kritisch prüfen. Positiv herleiten kann sie es nicht. Dass ‘es Wahrheit gibt’, ist zwar seine unverzichtbare Prämisse, aber es muss vorausgesetzt werden und lässt sich nicht nachweisen. So weit sie selber Wissenschaft ist, kann die Philosophie auf die Frage nach dem rechten Leben, die sie doch hervor-gerufen hatte, gerade nicht antworten.
Allerdings kann sie, gerade weil sie Wissenschaft ist, zeigen, was unter den zahllosen Sinn-Angeboten, die schon immer auf den Märkten gewimmelt haben, der Kritik nicht standhält und als Scharlatanerie und Bauernfängerei zum Tempel hinaus gepeitscht gehört.
Insofern hat die wissenschaftliche Philosophie ihr Geschäft noch lange nicht erledigt. Je mehr Weisheitschulen auf dem öffentlichen Platz sich tummeln und um die Gunst des Publikums buhlen, um so mehr bekommt sie zu tun. Ihr “praktischer” Teil geht überhaupt erst richtig los!
___________________________________________________
________________________________________

Gedanklich endet meine Wendeltreppe bei den Ergebnissen der ‘kritischen’ alias Transzendentalphilosophie. Das wurde beanstandet, denn danach hat die Zahl der philosophischen Bücher wohl noch um ein Vielfaches zugenommen…
Ich wollte aber keinen kurzen Lehrgang durch die Geschichte der Philosophie schreiben, sondern ein Einführung ins Philosophieren selbst. Ich meine im Ernst, dass der theoretischen Philosophie seit den Tagen der Transzendentalphilosophen substanziell nicht mehr viel hinzugefügt wurde. Wo es theoretischen Erkenntnisgewinn gab, handelte es sich weitgehend um die – philologische – Klärung von Missverständnissen. Wo die ‚Phänomenologie’ – Husserl und, in seinem Gefolge, Heidegger – zu brauchbaren Resultaten kommt, bestätigt sie doch immer nur, in weniger deutlichen Begriffen, die Ergebnisse der ‚kritischen’ alias Transzendentalphilosophie. Ich bin so kühn, mutatis mutandis dasselbe über die ‚sprachanalytisch’-pragmatische Schule unserer Tage zu behaupten.
Der Umkreis der philosophischen Themen ist im großen Ganzen abgesteckt. Innerhalb des Kreises mag das Feld immer und immer wieder neu bearbeitet und mögen den Themen immer wieder neue ‘Seiten’ abgewonnen oder das Gewonnene aus anderer Perspektive neu bestätigt werden. Tatsächlich ist die Philosophie seither so verfahren; soweit sie nämlich theoretisch und wissenschaftlich ist.
Doch hat sich seit dem 19. Jahrhundert, nämlich seit Schopenhauer und Kierkegaard eine Variante der Philosophie ausgebildet, die ausdrücklich nicht theoretisch und auch nicht wissenschaftlich sein will, die Lebensphilosophie. Ihren bislang wort- und gedankenmächtigsten Vertreter hat sie in Nietzsche gefunden. Ihr Ehrgeiz ist es, die Frage nach dem Sinn des Lebens unmittelbar und positiv aufzuwerfen und nicht länger über den Umweg metaphysischer Begriffsakrobatik. Philosophie soll praktische Lebenshilfe geben (und womöglich politisch wirksam werden). Damit ist sie im öffentlichen Leben so erfolgreich gewesen, dass sie im landläufigen Verständnis den Begriff der Philosophie ganz für sich vereinnahmt und die wissenschaftliche Philosophie in die akademische Ecke gedrängt hat.*
Ihr Publikumserfolg ist verständlich. Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich jedem Menschen. Und jeder stellt sich ihr – mal mehr, mal weniger bewusst. Was er dabei – auf sein Leben zurückblickend – jeweils an Antworten gefunden zu haben meint, das kann man Lebensweisheit nennen. Nichts steht ihm freier als das. Es fragt sich nur, ob sich daraus eine positive Lehre entwickeln lässt, die der eine dem andern mit einem Anspruch auf öffentliche Verbindlichkeit vortragen darf.
Oder anders, wissenschaftlich ist die Philosophie nur als Kritik. Wenn ich sage, man kann leben, ohne zu philosophieren, dann heißt das: Man kann leben, ohne Wissenschaft zu treiben. Um das Wort Philosophie – und wer es alles für sich in Anspruch nehmen darf – muss man sich nicht streiten. Auch die Philosophischen Lebensberatungs-Dienste unserer Tage dürfen sich so nennen, gesetzlich geschützt ist das Warenzeichen nicht. Aber ich bestehe auf einer scharfen Unterscheidung zwischen kritischer, wissenschaftlicher Philosophie und landläufiger Lebensweisheit.
Das ist eine politische Erfordernis.
Wissenschaft ist öffentliches Wissen. Sie ist entstanden, um in der Öffentlichkeit ein Feld abzustecken, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten, die immer auch von Interessen geprägt sind, vernünftiger Weise nicht mehr möglich sind. Dies ist ihr historischer Sinn. Das Aufkommen der Wissenschaften im Abendland des siebzehnten, achtzehnten Jahrhunderts war das politische Weltereignis. Herrschaft konnte von nun an gemessen werden an dem, was ‘als vernünftig erkannt’ war. Und nur so ist eine repräsentative, nämlich die Staatsbürger repräsentierende politische Ordnung überhaupt denkbar. Die Öffentlichkeit erwartet allerdings von der Wissenschaft, dass sie Gesetzestafeln erstellt, in die man die ‘konkreten Fälle’ nur noch einzutragen braucht, um die ‘richtige Lösung’ sogleich ablesen zu können. Es liegt daher im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Wissenschaft selbst, ihre Grenzen möglichst scharf zu ziehen.
Der einzig begründete Ausgangspunkt der praktischen Philosophie ist ein negativer: dass die theoretische Philosophie – nach den Ergebnissen der ‚Kritik’ – im Sein keinen Sinn nachweisen kann. Der Sinn ist das, was — nicht durch Notwendigkeit vorgegeben ist, sondern: – ‚durch Freiheit möglich’ wäre. Sinn kann man nicht finden, sondern muss man erfinden.
Ist er also beliebig?
Na ja. Jedenfalls nicht in dem ‚Sinn’, dass erlaubt ist, was einem grade ‚in den Sinn kommt’. Denn was aus Freiheit geschah, lässt sich zwar nicht ‚begründen’, nämlich aus theoretischen Einsichten herleiten; aber man wird es rechtfertigen müssen, nämlich vor mir selber und dann vor all denen, denen ich ihrerseits Freiheit zumute und denen ich über den Weg laufe. Dann wird man sehen…
Mit andern Worten: Würde ich nicht in einer Welt leben, die ich ‚in Freiheit’ mit Andern teile, bräuchte ich keine praktische Philosophie und keine ‚Sinn des Lebens’. Ich lebte vor mich hin, und damit gut.
*
Zwar kann die Wissenschaft (mit jedem Tag genauer) sagen, ‘was ist’. Denn das ist die theoretische Frage, die in ihr Ressort fällt. Aber was wer soll, ist eine praktische Frage, die nicht nach wahr oder falsch, sondern nach gut oder schlecht zu entscheiden ist. Und die fällt eben nicht in ihr Ressort: Denn gegenüber den Fragen des praktischen Lebens verhält sie sich, das sie theoretisch ist, rein kritisch: indem sie sagt, was nicht ist. Die Frage, wie und wohin ich mein Leben führe, ist ein praktische Frage; und eine private. Die Wissenschaft kann mir sagen, ob es good vibrations gibt, auf die ich rechnen darf, oder nicht; danach muss ich selber entscheiden.
Die Frage, wohin die Staaten und die Gesellschaften steuern, ist öffentlich, aber sie ist nur in Grenzen theoretisch. Denn Antwort hängt von denen ab, die sie stellen, und die sind Handelnde, bevor sie wissenschaftlich Erkennende sind; darum läuft die wissenschaftliche Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit immer hinterher und bringt es allenfalls zur self-fulfilling prophecy**. Und dabei ist die Frage, wohin sie steuern sollen, noch nicht einmal angeschnitten. Könnten die Gesellschaftswissenschaften wirklich voaussagen: Wenn ihr dies tut, geschieht das, und wenn ihr jenes tut, dann geschieht solches – dann müsste die Frage, ob wir ‘das’ oder lieber ’solches’ wollen, immer noch praktisch entschieden werden; ‘aus Freiheit’, wie Kant das nennt. So gibt es ein unmittelbares politische Interesse daran, dass sich die Wissenschaften ihrer Grenzen jederzeit klar bewusst bleiben; Hirnforschung incl.
*
Lebensweisheit ist dagegen eine Privatangelegenheit und gehört in “meine Welt”, wenn ich so sagen darf. Erstens geht sie nur mich selber an. Wenn ich zweitens darüber hinaus einen Drang spüre, meine Anschauungen (!) andern mitzuteilen, dann stehen mir dazu die Mittel der nicht-diskursiven Mitteilung zu Gebot; die Mittel der Kunst nämlich. Philosophie könne man eigentlich nur noch dichten, meinte Wittgenstein...
Wer künstlerische Berufung fühlt, der trete vors große Publikum. Der Kritik ist er dort freilich nicht entzogen, ganz im Gegenteil. Nur ist es jetzt die Kunstkritik – die umso unerbittlicher ist, als sie selber Teil des kritisierten Gegenstandes ist. Die Kunst hat sich im Laufe der Neuzeit wie die Wissenschaft zu einer gesellschaftlichen Instanz entwickelt, und die Kritik ist deren Teil. Wissenschaftlich ist sie nicht, sondern ästhetisch. Sie kan nicht (logisch) demonstrieren, sondern nur (anschaulich) zeigen. Sie kann – wie die Kunst selber – Beifall heischen, aber kein Einverständnis erzwingen, wie die Wissenschaft.
*
Das gilt im selben Maß von den praktischen Staats- und Gesellschaftslehren. Die wissenschaftliche Kritik kann ihnen ihre Grenzen zeigen – und dass sie nicht Fleisch von ihrem Fleisch sind. Sie selber haben sich der Öffentlichkeit möglichst anschaulich darzustellen. Sie fordern zu Wertentscheidungen heraus, und die sind – in weitestem Sinn – ein ästhetischer Akt. Doch das Ästhetische liegt nicht jenseits der Vernunft, sondern diesseits. Es liegt ihr zu Grunde.
**) In einer UFA-Komödie sagt Grete Weiser: “Wie soll ich wissen, was ich meine, bevor ich höre, was ich sage?” So geht es ‘der Gesellschaft’, wenn sie sich nach den Zielen ihres Handelns fragt. Wie können wir wissen, was wir wollen, bevor wir sehen, was wir tun?
Es fängt bei der Namensgebung an. “Natur”wissenschaft… im Unterschied, im Gegensatz zu was? Zu Geisteswissenschaft, Moral science, Humaniora? Der Unterschied ist nicht selbstverständlich, und darum wurde er auch nicht immer gemacht. Bei den Antiken erscheinen Physik und ‘Meta’-Physik noch ganz ungescheiden, erst bei Aristoteles werden sie wenigstens auf verschiedene Bände verteilt; aber schon bei den – dann lange Zeit Ton angebenden – Neuplatonikern (Plotin, Proklos) treten sie wieder vermengt auf. Sachlich notwendig wird sie auch wirklich erst mit Galileo, der mit der Mathematisierung der Formeln zuerst ein Kriterium eingeführt hat, um ’strenge’ Wissenschaft von mehr oder minder plausiblem Dafürhalten zu unterscheiden. Mit Descartes ist dieses Kriterium fürs Abendland verbindlich geworden: Wissenschaft spricht wahr, und der Maßstab für die Wahrheit der Aussagen ist, dass sie ’so klar und eindeutig bewiesen werden können wie die Demonstrationen der Geometrie’. Nur was sich in einem mathematischen Modell darstellen lässt, lässt sich mit mathematischer Sicherheit beweisen.
Dass ‘Natur’ eo ipso in ein mathematisches Modell gehört, war damit stillschweigend unterstellt. Die Unterstellung ist geschehen, indem sich Galileo ausdrücklich aus der aristotelischen Meta-Physik zurück besann auf Platos ‘Ideen’-Begriff und seiner Anschauung der reinen Formen (’vollkommene Körper’) in der Mathematik. Dass damit ‘allein die Natur’ zu erfassen wäre, war damit noch gar nicht positiv gesetzt. Es ergab sich negativ, indem ein Rest übrig blieb, der sich nicht in mathematischen Modellen darstellen lässt; eben die ‘nicht-exakten’ Wissenschaften: Wissenschaften im eingeschränkten Sinn…
Descartes hat schon zu seiner Zeit energischen Widerspruch gefunden, der zu seiner Zeit aber ungehört blieb. Giambattista Vico stellte der Idee von der mathematischen Durchschaubarkeit von Gottes Schöpfung den Grundsatz entgegen, dass einer nur das ‘wahr’ erkennen könne, was er selber gemacht habe: “Verum et factum convertuntur”, ‘wahr’ und ‘gemacht’ bedeuten dasselbe. Die Natur habe Gott gemacht und der allein könne sie erkennen. Der Mensch hat seine Geschichte (seine Kultur, seine Kunst…) gemacht, und die allein könne er verstehen.
In einen Gegensatz sind Physik und Philosophie mit dem Beginn der industriellen Revolution faktisch getreten. Es war ein Streit um die Deutungshoheit im gesellschaftlichen Raum, den die Philosophie ab Mitte des 19. Jahrhunderts nur verlieren konnte. Der Rückgriff auf G.Vicos Gedanken erfolgte gegen Ende des Jahrhunderts, als Philosophie und Geschichtswissenschaft gegen den bloßen Positivismus der ‘Natur’- und Ingenieurswissenschaften neu zu behaupten suchten.
Eine positive Bestimmung hat dann wohl zuerst Wilhelm Dilthey (1833-1911) unternommen. Während der Mensch im ersten Fall ‘die Natur außer ihm’ untersucht, betrachtet er in den “Geistes”-Wissenschaften ’sich selbst und seine Werke’. Gilt es bei jenen, die Dinge aus ihren Ursachen zu erklären, suchen diese, die Taten den Menschen aus ihren Motiven zu verstehen. Die Methode hier ist rationale Rekonstruktion, dort intuitive Einfühlung.
Das ist früh als unbefriedigend empfunden worden. Plausibel und für die Konversation tauglich ist es wohl, aber sobald man sich den wissenschaftlichen Grenzfällen nähert – für die die Unterscheidung ja taugen soll, nicht aber für die unstrittigen Fälle! -, lässt sie sich nicht konsequent durchführen. Generell schon darum nicht, weil seit Kant (von dem auch Dilthey ausging) auch in den Naturwissenschaften das menschliche Apriori – die ‘Kategorien’ und die ‘transzendentalen Anschauungsformen’ Raum und Zeit – immer schon mit enthalten ist. Und im Besondern wird es deutlich bei der immanenten Methodenreflexion der Naturwissenschaften: Beschäftigt sich Wissenschaftslogik mit der Natur außer uns oder mit uns selbst und unsern Werken?! Gänzlich verwirrend wird es beim Prüfstein der Naturwissenschaftlichkeit selber: der Mathematik – und da verstrickte uns diese Unterscheidung unversehens tief in die Metaphysik, und die Katze bisse sich in den Schwanz.
Wilhelm Windelband (1848-1915) sah es als irreführend an, die beiden großen Wissenszweige nach ihren Gegenständen unterscheiden zu wollen: Es stecken viel zu viele Prämissen da schon drin! Zweckmäßiger sei es, zunächst ihre Verfahrensweise und eo ipso ihre Erkenntnisabsichten zu unterscheiden: Die ‘Gegenstände’ werden sich finden…
Es gibt Wissenszweige, die in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen nach durchgehenden Regelmäßigkeiten suchen, und wenn sie sie finden, stellen sie sie womöglich in mathematischen Formeln dar. Diese nennen sie ‘Naturgesetze’. Wissen- schaften, die sich um die Formulierung von
Man solle daher nicht sagen: Die Geschichtswissenschaft (Gesellschafts-, Literatur-, Sprachwissenschaft…) “ist” idiographisch, “weil” ihr Gegenstand nichts anderes zulässt und man sich bescheiden muss, immer nur ein historisch eingrenzbares Einzelnes nach allen seinen Seiten auszuleuchten. Man kann auch immer auf diesen Feldern quer durch die Geschichte hindurch nach ‘Gesetzmäßigkeiten’ suchen. Freilich wird man ihr Vorhandensein nun nicht mehr arglos voraus setzen können. Und hat man faktische Regelmäßigkeit (=Wahrscheinlichkeiten) wirklich aufgefunden, wird man immer noch begreiflich machen müssen, was daran notwendig gewesen sein mag
Im übrigen ist es nicht das Fehlen einer gesetzgeberischen Prätention, die die idiographische Disziplinen weniger exakt macht als ihre ‘naur’wissenschaftliche Schwestern; das macht sie im Gegenteil weniger spekulativ. Sondern dass sie ihre theoretischen Vermutungen nicht an überprüfbaren Experimenten öffenbtlich bewahrheiten kann. Das Gedankenexperiment muss ihnen den Laborversuch ersetzen, und das ist weniger exakt als die Versuchsanordnung; denn Denkfehler sind ansteckend.
Kurz gesagt: Im Unterscheid zu Diltheys dogmatischer Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften ist Windelbands Unterscheidung von nomothetischen und idiographischen Disziplinen eine heuristische und daher kritische Bestimmung.
Und eins ist klar: Was die letzten Endes alles entscheidende Frage angeht, was der Mensch in der Welt soll – da bringen sie uns, wie wissenschaftlich auch immer, nicht einen Fuß breit weiter als ihre naturwissenschaftlichen großen Brüder. Denn was der Mensch in seiner Geschichte schon so alles gemacht hat, das “beweist” lediglich, welche Möglichkeiten er wirklich hatte, denn er hat sie ja ergriffen. Welche andern Möglichkeiten er vielleicht auchnoch gehabt hätte, aber eben nur nicht ergriffen hat, darüber sagt es nichts. Und noch weniger, ob er es gesollt hätte. Noch darüber, welche Möglichkeiten er heute und morgen hat und haben wird, und was er daraus machen soll.
Ich sage nicht, dass jenseits der wissenschaftlichen kritischen Philosophie jedes praktische Urteil in concreto ästhetisch motiviert ist. Ich sage nur, dass das “poietische Vermögen” – also dasjenige, das den Menschen zum Qualifizieren befähigt – selber ästhetischer Qualität ist. Erstens glaube ich, dass dem historisch so ist , und zweitens meine ich, dass dem von Rechts wegen so sein soll.
Insofern meine ich “das Ästhetische” überhaupt nicht psychologisch , sondern ‘transzendental’: “Das ästhetische Vermögen ist die Fähigkeit, Qualitäten wahr-, d. h. wertzunehmen. Die Urteilskraft ist das Vermögen, Erscheinungen auf Qualitäten zu beziehen.”
Das Politische ist nicht selbst ‘ästhetisch’
In jedes einzelne, ‘historische’, empirische Urteil praktischer Natur – das heißt: jede poltische Entscheidung – fließen in concreto stets eine Unmenge konkreter ‘idiotischer’ Daten ein, die ‘auf Qualitäten bezogen’ sein wollen; aber das muss eben immer
Die Politik selber als praktische Disziplin kann nicht theoretisch oder gar wissenschaftlich sein.
Wissenschaftlich kann die Kritik sein. Nicht die Kritik an dieser oder jener konkreten Entscheidung , sondern an dem ‘Modell’, auf das sie sich (u. U.) bezieht. Die mehr oder weniger theoretischen Modelle, auf die politische Akteure ihr Handeln beziehen mögen, können selber nur in einem idiographischen Sinn ‘wissenschaftlich’ sein. Das heißt beschreibend und empirisch verallgemeinernd, nicht aber nomothetisch-’gesetzgebend’. Die Situation, wo man in ein theoretisches Modell (der Gesellschaft) nur noch die empirischen Daten einzutragen bräuchte, um heraus zu lesen, was zu tun ist, wird… niemals eintreten.
An dieser Stelle wird unweigerlich – sei es höhnisch, sei es nostalgisch – an die Marx’sche Theorie von der Weltrevolution erinnert.
“Historischer Materialismus”
Da trafen zwei theoretische Perspektiven zusammen. Zuerst die kritische: Die Kritik der politischen Ökonomie hatte zum Ergebnis, dass das theoretische Modell des ‘Wertgesetzes’ wissenschaftlich nicht haltbar war, weil der vorgeblichen Regel des Äquivalententauschs ein ungleicher Tausch zwischen Kapital und Arbeit zu Grunde liegt. Damit wurde die Rechtfertigung der kapitalistischen Gesellschaftsform durch das ‘Klassische Modell’ der Politischen Ökonomie, das sie zu einem ‘System’ metaphysiziert, hinfällig. Ein eignes positives Modell vom Funktionieren der bürgerlichen Gesellschaft findet man bei Marx nicht. Er hatte es ursprünglich im Sinn; aber da ahnte er noch nicht, dass seine beabsichtigte Vollendung der Politischen Ökonomie in deren Kritik umschlagen würde; das hat er erst gemerkt, als er das (fälschlich so genannte) ‘Formen-Kapitel’ der (fälschlich so genannten) ‘Grundrisse’ niederschrieb.
Der andere theoretische Strang ist die “materialistische Geschichtsauffassung”. Auch die ist ursprünglich kritisch. Sie richtet sich nämlich gegen die hergebrachte Auffassung, dass in der Menschheitsgeschichte Gesetze wirksam wären, die ihr von außerhalb auferlegt wären: von übersinnlicher Instanz. Ihre eigne ‘Voraussetzung’ ist lediglich, dass sie diese Voraussetzung zurückweist. ‘Materialistisch’ bedeutet schlicht und einfach nicht-spiritualistisch. Ihr selber liegt allein das empirische Prinzip ‘zu Grunde’, dass die Menschen ihre Geschichte selber machen. Ab da tut sie das, was Geschichtsschreibung zu tun hat: Sie beschreibt. Dafür ist wiederum besagtes ‘Formen’-Kapitel das beste Beispiel. In der literarischen Darstellung muss diese wie jede andere Beschreibungen schematisieren, die Fakten bestimmten Handlungsfäden zuordnen; wobei sie erklärtermaßen nicht ‘Alles’ beschreibt, sondern ihr Augenmerk auf die Herausbildung und dem Verhältnis der Gesellschaftsklassen richtet.
Die Epigonen – nicht erst Stalins Hofschranzen, sondern schon früher Dogmatiker wie Karl Kautsky – haben dann die ‘Handlungsfäden’ zu historischen Gesetzen entmaterialisiert. Und so ein kritische und revolutionäre Theorie in ihr staatserhaltendens Gegenteil verkehrt: Stalins terroristisch-totalitäre Monstrum brauchte eine Offenbarungslehre, durch die es als letztes Wort “des Gesetzes” imponieren konnte; “Vorsehung”, echote Stalins Spiegelbild im Führerbunker.
Modelle
Wenn aber die wisschenschaftliche Beschäftigung mit der Politik ohnehin nie dahin kommt, Gesetze aufzustellen – wozu taugen dann noch ihre theoretischen Modelle?
Ein Modell ist kein Gesetzbuch. Ein Gesetzbuch ist dafür da, den Fall einer Regel zu sumbsumieren. Das ist der Zeck der Naturwissenschaft. Das Modell ist Abbild eines idion. Es ist nicht die naturgetreue Nachbildung von ‘allem, was dazu gehört’, sondern ein Schema; ein Sinnbild, das wiedergibt, worauf es andem Idion dem Modellbauer angekommen ist; worauf er es abgesehenhat.
Zum Modellbauen gehört erstens die ‘Eingrenzung’ des Idion, und zweitens seine ‘Struktur’. Das bedeutet nichts anderes als Extensio und Intensio des Begriffs. Der Begriff hat – nämlich als Problem, wenn es ihm auch anders vorgekommen sein mag – dem Modellbauer ‘vorgeschwebt’. Die Sistierung, Fixierung des Vorschwebenden ist eben: die Ausührung des Modells. Das Modell ist die De-Finitio des Begriffs.
Hier wird klar: Das Idion ist kein Singulare; kein Einzelding, sondern eine Ganze Gestalt. Von einem Einzelding gibt es keinen Begriff, de singularibus non est scientia, da braucht man kein Modell. Einen Begriff braucht man für ein Mannigfaltiges, das von anderm Mannigfaltigen unterschieden werden soll. Er ist die Sinnbehauptung eines inneren Zusammenhangs; einer ‘Struktur’, wenn man diesen Ausdruck mag. Er ist keine Formel, in die man das konkrete Datum einträgt, um ein Ergebnis heraus zu rechnen, sondern eine Form, die man an eine lebendige Gestalt heranträgt, um zu sehen, ob sie passt.
Begriff ist Absicht, und die ist praktisch.
Der Begriff ist ein Sinnträger. Wer ihn verwendet, muss vorher wissen, wozu. Im Begriff ist ein Absehen ‘gemerkt’. Die Verwendung des Begriffs ist die Aktualisierung dieser Absicht. Wer ihn verwendet, muss wissen, dass er kein Gesetz anwendet, sondern einer Absicht folgt.
Kritik – die Wissenschaft – ist dazu da, ihn jedes Mal daran zu erinnern, wenn der “dialektische Schein” ihm schon wieder Mal eine metaphysische Substanz vorgaukeln will.
Absichten sind qualitativ. Das Vermögen, Erscheinungen auf Qualitäten, Tatsachen auf Absichten zu beziehen, ist die Urteilskraft. Das Vermögen, Qualitäten wahr-, d. h. wertzunehmen, heißt das ästhetische.
Die Philosophie fragt nicht danach, wie Menschen wirklich denken. Viele denken so, aber einige denken ganz anders. Im tatsächlichen Denken spielen Zufälle und äußere Verursachungen eine Rolle, Motive und Hindernisse. Wie und warum – das interessiert den Psychologen. Den interessieren aber nicht die Ergebnisse des Denkens, nämlich ob sie ‘zutreffen’ oder nicht. Ihn interessiert allenfalls, ob und warum der Denkende gelegentlich ganz etwas anderes tut, als er beabsichtigt hat: Dafür will der eine ‘Gründe’, der andre ‘Motive’ herausfinden…
Angenommen, es ließe sich mit allerletzter Sicherheit herausfinden, was im Bereich der Psychologie wahr ist – so wäre doch immer noch das, was in unserer Psyche vorgeht, Ergebnis eines Millionen Jahre alten faktischen Entwicklungsprozesses. Und von dem müsste man im Grundsatz annehmen, dass er möglicherweise an diesem oder dem andern Punkt auch anders hätte verlaufen können. In diesem Sinne handelt es sich um ein “Naturgeschehen”. Und dieses ist immer bedingt.
Sollten also die Hirnforscher demnächst herausfinden, dass der Satz “zwei mal zwei ist vier” durch die Evolution irgendwo in unseren grauen Zellen genetisch einprogrammiert ist, dann wäre das lediglich eine Anpassung an gegebene Umstände gewesen, die einen Selektionsvorteil begründet hat. Durch diesen wäre sie bedingt. Doch dass 2×2 wirklich =4 ist, wäre damit absolut nicht bewiesen! Dazu bedürfte es immer noch einer eigenen logischen Operation.
Bedeutungen
Bei philosophischen Fragestellungen geht es nicht (mehr) um das Tatsächliche. Über das muss man sich, und sei es nur vorläufig, schon geeinigt haben. Bei philosophischen Fragen geht es vielmehr um Bedeutungen. Nicht um das Tatsächliche, sondern um das “Logische”, nämlich um Sinnbezüge und Geltungen. Das sind Bestimmungen, die außerhalb von räum- lichen und zeitlichen (und also zufälligen) Bedingungen liegen. Eine Tat hat einen “Sinn” auch noch tausend Jahre, nachdem sie getan wurde, oder sie hat nie einen gehabt; und zwar unbedingt. Unbedingt im Übrigen auch dadurch, ob je einer diesen Sinn erkannt hat oder nicht. Und eine Aussage “gilt” auch dann, wenn die Gegenstände, über die sie ausgesagt wurden, längst nicht mehr existieren; und wenn kein Lebender sie je ausgesprochen hat!
Der Philosoph dagegen fragt, wie das – jedes! – Denken verfahren muss, wenn es wahr sein soll, und damit es wahr sein kann. Wahrheit ist Zweck seines Fragens, und in Hinblick auf diesen Zweck verfährt er ‘pragmatisch’. Ihn interessiert nur, was diesen Zweck fördert, und nicht das, was ihn stört. Zu beachten: Was immer dieser oder der Philosoph jeweils lehren mag – dass Wahrheit ’sein soll’, setzt er stillschweigend voraus, indem er Aussagen macht, die beanspruchen, als wahr zu gelten!
Der Satz “Es gibt keine wahren Sätze” (einige Denker neigen dieser Auffassung zu) widerspricht durch seine kategoriale (Urteils-) Form seinem (materialen) Gehalt. Es ist ein ähnlicher Fall wie das berühmte (Schein-) Paradox “Alle Kreter lügen”. Kommunikationstheoretisch ausgedrückt: Die Meta-Rede hebt die Objekt-Rede auf. Dieser Satz ist Sinn-widrig. Und nicht nur wird die Möglichkeit wahrer Sätze stillschweigend vorausgesetzt, sondern damit zugleich auch die Fähigkeit, ‘aus Freiheit’ äußere Verursachungen und innere Versuchungen aus meinem Denken auszuscheiden. Einem jeden steht es natürlich frei, diese Voraussetzungen zu bestreiten. Nur muss er sich dann aus der Erörterung von Aussagen, die wahr sein wollen, heraushalten.
Das Urteil und sein Grund
Mit der ‘Wahrheit’ ist es dasselbe Problem wie mit der ‘Freiheit’. Der Satz ‘der Mensch ist frei’ – bis heut ein Dauerbrenner der abendländischen Geistesgeschichte – ist theoretisch schlechterdings nicht beweisbar und also nicht diskutabel. Er lässt sich nur in der Form ‘der Mensch soll frei werden’ oder ‘du sollst handeln, als ob du frei wärst’ moralisch postulieren. Dennoch ist er mehr als bloße Meinung. Denn sein Gegen-Satz ‘Der Mensch ist unfrei’ lässt sich ohne inneren Widerspruch nicht formulieren.
Die Frage, ob wohl unser Wissen einen hinreichenden Grund hat – und daher ‘wahr’ ist -, lässt sich theoretisch, also im Rückgriff auf einen höheren (oder ‚tieferen’) Urteilsgrund nicht entscheiden – sonst wäre der jeweils aufgefundene Grund seinerseits begründet, und wir wären so klug wie vorher. Theoretisch stehen wir vor einem gordischen Knoten, der nicht gelöst, sondern nur zerschlagen werden kann: Unser Wissen muss einen Grund haben – weil anders all unsere Sätze ohne Sinn wären.
Hier wie oben wäre die entgegen gesetzte Annahme absurd: Keiner von uns könnte sie sinnvoll aussprechen, er müsste lallen oder den Mund halten. Wenn es im Leben einen Sinn geben soll, dann muss das Wissen einen Grund haben. Wer meint, das Leben bräuchte keinen Sinn, der kann nicht widerlegt werden. Er müsste sich allerdings aus der Erörterung sinnvoller Fragen heraushalten. Denn wer das Nichts behauptet, behauptet nichts, sagt Heidegger.
Die Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt, ist Unfug. Die Antwort darauf wäre, wie immer sie ausfiele, wahr oder unwahr. So kann man nur fragen, weil man sich von der Wahrheit längst eine Idee gemacht – und also die Antwort “in Wahrheit” schon vorausgesetzt hat.
Wahrheit ist kein vorhandener Stoff, den die empirischen Wissenschaften mit den geeigneten Instrumenten bei genügend schlauer Versuchsanordnung schon noch nachweisen werden, sondern ein Postulat. Sie “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor”. (vgl. Die philosophische Wendeltreppe XV)
Reflexiv
Die ‘Anpassung’ unserer Gehirnfunktionen durch Jahrmillionen von natürlicher Auslese geschah nicht um dieser Idee, sondern um des Überlebens willen. Es ist eine empirische, eine historische Tatsache – es ist eine ‘phänomenale Gegebenheit’, dass jene Gruppe von Vermögen, die wir zusammen fassend Vernunft nennen, uns durch die Evolution angestammt wurden. Woher sie auf uns gekommen sind, ist das eine. Das andre ist: Jetzt sind sie da. Und jetzt wenden wir sie auf alles an, was uns begegnet; auch auf unser Herkommen – und sogar auf sie selbst. Die Vernunft ist – das ist das ungelöste Mysterium der Hirnforschung – an und für sich reflexiv. Sie kann selbst ‘hinter sich zurück’ gehen, und darum ist sie selber unhintergehbar.

Der Weg eines Wissensfachs von der Aporetik, die zwanglos von einem Problem zum andern fortgeht, so wie sie es sich (praktisch) stellen, zur Wissenschaft ist in den idiographischen Disziplinen nichts anderes als die Ausarbeitung des theoretischen Modells, in dem das Idion logisch schematisiert ist. Es ist die Bestimmung eines Begriffs – seinem Umfang (extensio) und seinem Inhalt (intensio) nach.
Gibt es von „Erziehung“ einen Begriff? Kann es eine Erziehungswissenschaft geben?
Der Begriff wäre die Antwort auf die Frage: Wer tut da was mit wem? Das ist das Idion. Wer mit wem, das wäre der Umfang; was, das wäre der Inhalt. Das Wie wäre gegebenenfalls Gegenstand des historischen Berichts, und wenn überhaupt, dann ließen sich aus ihm verallgemeinernde Sätze ableiten, die zwar ‚Gesetzlichkeit’ nicht für sich in Anspruch nehmen, aber doch einen pragmatischen Hinweis geben könnten, was man versuchen kann und was man besser unterlässt. Doch dies ist klar: Ohne Wer-was-mit-wem kann nach Wie gar nicht erst gefragt werden. Nicht nur auch, sondern gerade als historisches Fach ist „Erziehungswissenschaft“ auf einen klaren und bestimmten Begriff angewiesen.
Ich mache es kurz: Die pp. Erziehungswissenschaft, d. h. ihre Königsdisziplin, die Allgemeine Pädagogik, kann einen solchen Begriff nicht geben.
„Erziehen = Von einem Menschen s1 auf einen Menschen s2 gerichtetes absichtsvolles und geplantes Zuführen von Impulsen mit dem Ziel, dass s2 diese Impulse als Reize oder Informationen so verarbeitet, dass s2 Verhaltensbereitschaften bewahrt oder erwirbt oder so verändert, das s2 (in einer festgelegten Zeit) Verhalten realisiert, das den Soll-Zuständen von s1 entspricht.“ Diese denkwürdige Definition, die uns Lutz Michael Alisch und Lutz Roessner in „Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis“* gegeben haben, trifft auf den Bananenverkäufer auf dem Wochenmarkt und auf den Schaffner in der Straßenbahn ebenso zu. Ist sie bloß ein Kuriosum? Nein, sie spricht die Hilflosigkeit der ganzen Branche aus.
Irgendwie hat es mit Erwachsenen und mit Kindern zu tun (und kommen Sie mir jetzt nicht mit ‚Erwachsenenpädagogik’, Sie bringen ja alles nur noch mehr durcheinander!). Ach, und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, da stellen wir sogleich fest, dass es den ‚Begriff’, genauer: das Wort ‚Erwachsener’ grad mal seit zweihundert Jahren gibt – man merkt es schon an der verlegenen grammatikalischen Form: ein substantiviertes Partizip Perfekt. Vorher gab es Männer und Frauen (und Mütter und Väter); aber ein soziales Corps, das einem andern sozialen Corps namens Kinder als dessen Oppositum auflauerte, das gab es nicht. Denn ein kint war noch im Mittelhochdeutschen zunächst ein Sohn oder eine Tochter, später konnte jeder Jüngere jedem Älteren gegenüber ein kint heißen. Nur einen bestimmten biologischen Entwicklungsstand – das bedeutet ‚Kind’ erst in der bürgerlichen Gesellschaft.
Tatsächlich entsteht der Sozialstatus ‚Kind’ erst in eben dem Maße, wie die Angehörigen der sich ausbildenden bürgerlichen Gesellschaft zu ‚autonomen Subjekten’ (in der Philosophie), zu ‚Warenproduzenten’ (in der Nationalökonomie) und zu ‚Berufsmenschen’ (in der Soziologie) erwachsen. Seither erst kommen auch die Vokabeln ‚Erziehung’ und ‚Pädagogik’ in Gebrauch. Die Marktwirtschaft sorgt für einen so hohen Grad gesellschaftlicher Arbeitsteilung, dass an ein stilles, stetiges Hineinwachsen wie in den Handwerksstuben und den Bauernhöfen des Ancien Régime nicht mehr zu denken war. Seither bedarf es einer besonderen Schutz-, Dressur- und Zubereitungsphase, um zu einem vollgültigen Glied der Berufswelt gemacht zu werden. Von Pädagogen, von wem denn sonst?
Darum ist Pädagogik ein „Fach“, und darum braucht es eine „Erziehungswissenschaft“. Seine Extensio – das sind die Versorgungsansprüche der Pädagogen. Ihre Intensio sind die Wörter, die sie gebrauchen, um diesen Umstand zu verschleiern. Vorangegangen ist auf diesem Wege Friedrich Daniel Schleiermacher, den sie darum mit Grund als ihren Stiftungsvater erkennt.
Historisch war es zwar Johann Friedrich Herbart, der sie eine halbe Generation zuvor mit seiner Allgemeinen Pädagogik als akademisches Fach begründet hat. Aber er war ein erklärter Gegner der Schule. Und zwar nicht zuletzt aus diesem Grunde: weil sie auf die Dauer einen Berufsstand züchtet, dessen Eigeninteresse sich an die Stelle der pädagogischen Zwecke zu drängen neigt – zumal, wenn es „in öffentlichem Dienst“ auftreten darf. Kein Wunder, dass man ihm einen Schleiermacher vorzieht.
Der allererste Schritt beim Verschleiern ist, den pädagogischen Berufsstand aus dem Blickfeld verschwinden und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“
und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“
Da „die jüngere Generation“ hier nur als Objekt in Frage kommt, die nichts zu „wollen“ hat, mag ihm dieser Ausdruck hier durchgehen. Wenn aber die „ältere Generation“ etwas will, dann… muss sie ein Subjekt sein. Das ist sie offenkundig nicht, wie sollte sie? Der Ausdruck ist eine bloße Mystifikation, unter der sich ein materielles Interesse tarnt. Die Pädagogenschaft „will“ stellvertretend für alle andern.
Man hätte wohl meinen können, mit der ‚älteren Generation’ seien hier die Eltern von Kindern gemeint. Aber deren „erziehende Tätigkeit verteilt sich ihnen unter ihr ganzes übriges Leben und tritt nicht gesondert hervor.“ Davon gibt es daher keine Wissenschaft. „Man bezieht also die Erziehungslehre auf diejenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen“ – verschämt ausgedrückt; man bezieht es also auf die Erwerbspädagogen.
Wie kommen die aber zu ihrer Stellvertreterrolle, was rechtfertigt sie? Plötzlicher Anflug christlicher Demut: „Ich sehe keinen andern Rat, als an dieser Stelle unserer Untersuchung abzubrechen und zu sagen, wir müssen an die jetzt bestehende Form der Erziehung unsere Theorie anschließen.“ Und das ist die Quintessenz des Ganzen! Zum Trost breitet er uns einen Weihrauchschleier drüber: Es nennt ‚das Ganze’ „Praxis“, und damit ist es glücklich aller Kritik entzogen; der wissenschaftlichen zumal.
Wissenschaft ist öffentliches Wissen. Sie ist entstanden, um in der Öffentlichkeit ein Feld abzustecken, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten, die immer auch von Interessen geprägt sind, vernünftiger Weise nicht mehr möglich sind. Dies ist ihr historischer Sinn.
Das Aufkommen der Wissenschaften im Abendland des siebzehnten, achtzehnten Jahrhunderts war das politische Weltergeignis schlechthin. Herrschaft konnte von nun an gemessen werden an dem, was ‘als vernünftig erkannt’ war. Und nur so ist eine repräsentative, nämlich die Staatsbürger repräsentierende politische Ordnung überhaupt denkbar.
Die Öffentlichkeit erwartet allerdings von der Wissenschaft, dass sie Gesetzestafeln erstellt, in die man die ‘konkreten Fälle’ nur noch einzutragen braucht, um die ‘richtige Lösung’ sogleich ablesen zu können. Es liegt daher im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Wissenschaft selbst, ihre Grenzen möglichst scharf zu ziehen.
Nirgends ist das dringlicher als bei der Erziehung der heranwachsenden Generationen. Schon wegen unserer Zukunft, nicht wahr? Aber auch, weil der Steuerzahler sein Geld nicht gern vergeudet.. Doch die Öffentlichkeit glaubt nur zu gern, dass die Erziehungswissenschaft ihr Gesetzestafeln zeigt, aus denen abzulesen ist, „was zu tun sei“. Doch eben das kann sie nicht bieten. Sie ist keine ‚nomothetische’ Disziplin, die Naturgesetze freilegt, die auf die „Praxis“ nur noch anzuwenden wären. Die ein jeder, unabhängig von Stand und Geburt, aber unabhängig auch von persönlichem Vermögen, nur zu lernen bräuchte, um sie zu beherrschen. Gesetze, die eine berufliche Zunft als Ganze rechtfertigen könnten und den Einzelnen seiner Verantwortung enthöbe…
Und so hätte es gern auch die Erwebserzieherschaft. Ihre Vorlieben sind Techniken, Methoden und Strukturen, über nichts reden sie lieber. Dass zum Pädagogen nur taugt, wer dazu taugt, kommt unter den Teppich. Störend ist das Wuchern der sogenannten Erziehungswissenschaften nicht an sich selbst – das wäre nur ein akademisches (und vielleicht fiskalisches) Problem. Störend, nein: katastrophal ist, dass die Fiktion einer Wissenschaft, die „die Praxis begründet“, den Beruf des Erziehers radikal entwertet, indem sie seine personale Verantwortung an ein Drittes delegiert – eine anonyme Instanz, einen Wörterberg, den man dreht und wendet wie man will, weil er sich nicht wehren kann. Doch was er zu tun und zu lassen hat, muss der Erzieher selber wissen
Nicht „zu viel Wissenschaft“ gibt es bei uns im Erziehungsgetriebe. Davon kann es gar nicht zu viel geben, wenn man es so versteht, wie es in einem idiographischen Fach nur zu verstehen ist: als Kritik. Sondern es gibt zu viel Pseudowissenschaft, und umso mehr Kritik ist nötig: an dem „dialektischen Schein“, dass aus dem bloßen Kombinieren von Begriffen sachliche Erkenntnis möglich würde. Newtons nil in verbis! gehört über unsere Schulportale geschrieben.
Die empirische Sozialforschung kann – in Längs- und in Querschnitten – herausfinden, welche Institutionen in der Geschichte ursächlich irgendwie mit der Verbreitung einzelner kultureller Kompetenzen in einem Gemeinwesen zusammenhängen. Aber die Summe dieser Kompetenzen insgesamt begrifflich unter „Erziehung“ zu fassen, ist genau so ein definitorischer Gewaltakt wie „Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst“. Darauf können sich Forscher in heuristischer Absicht einstweilen verständigen. Aber ansonsten ist es rein nominal und Schall und Rauch.
Eine solche historisch vergleichende Wissenschaft „vom Erziehen“ könnte, wenn sie eben mehr sein wollte als ein Zweig der Humanethologie, nur die Meinungen sammeln, die andere Leute über ein X geäußert haben, das sie „Erziehung“ nannten – und sie logisch-kritisch aufbereiten. Darüber hinaus kann sie in literarischer Sprache erzählen, was dieselben Leute – soweit man es sehen kann – dabei getan haben. In einer irgend exakten Weise beobachten kann sie es aber nicht, denn eben dazu bräuchte sie Begriffe, die sie nicht hat noch haben kann. Und in ganz besonders farbigen Worten kann sie uns ausmalen, was dabei „herausgekommen“ zu sein scheint – im Guten wie im Bösen. Das ist wörtlich gemeint: Es ist am Ende eine Frage von gut und böse. Das taugt nicht für Wissenschaft, sondern für den Roman.
In nüchterne Worte gebracht, zerfiele diese Forschungsrichtung in 1) Doxologie, und 2) historische Institutionssoziologie. Aber wie die beiden zusammenhängen – folgt die Meinung aus den Institutionen oder folgen die Institutionen aus den Meinungen; oder was heißt hier „Wechselwirkung“? – das bleibt immer Sache eines hermeneutischen Kunststücks. Und so allein gehört Wissenschaft in die pädagogischen Ausbildungspläne – historisch und kritisch.
Denn was er tun soll, muss ein Erzieher eben selber wissen. Er ist ein darstellender Künstler, der es immer drauf ankommen lassen muss.
*) München 1981, S. 38
_______________________________________________________________________
 …notierte Novalis, als er Fichte
gelesen hatte. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man
Sittlichkeit nicht lernen kann wie irgend ein Pensum. Kann aber darum
keiner was für den andern tun? Muss jeder wieder ganz allein aufbrechen
und sehen, wo er bleibe? Nachdem so viel geschehen ist in der Geschichte
und sich schon so viele vor uns an den Rätseln der Welt versucht haben?
Dann hätten sie uns all ihre Zeugnisse ja ganz umsonst nachgelassen!
Nein, definieren lässt sich das Rätsel vom Sinn allerdings nicht. Aber es lässt sich zeigen.
…notierte Novalis, als er Fichte
gelesen hatte. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man
Sittlichkeit nicht lernen kann wie irgend ein Pensum. Kann aber darum
keiner was für den andern tun? Muss jeder wieder ganz allein aufbrechen
und sehen, wo er bleibe? Nachdem so viel geschehen ist in der Geschichte
und sich schon so viele vor uns an den Rätseln der Welt versucht haben?
Dann hätten sie uns all ihre Zeugnisse ja ganz umsonst nachgelassen!
Nein, definieren lässt sich das Rätsel vom Sinn allerdings nicht. Aber es lässt sich zeigen.
Unter den hinterlassenen Reichtümern der vergangenen Generationen ist kaum einer, der ganz allein dem Stoffwechsel diente und der Erhaltung des Leben so, wie es war. Fast jeder Gegenstand, jedes Werk weist in seiner Gestaltung einen kleinen Überschuss – Entwurf, disegno, design - auf, der nicht nötig gewesen wäre zu seinem bloß sachlichen Nutzen. Dieses Mehr betrachten wir als seine ästhetische Seite. Sie war immer auch eine Art Stellungnahme zur Frage nach dem Sinn der Welt, mal mehr, mal weniger absichtlich. Und je mehr sein Schöpfer jeweils selber meinte, in seinem Werk die Frage beantwortet zu haben, umso sicherer erkennen wir Kunst darin, und die ist uns noch rätselhafter als die Natur, weil sie sich selbst für eine Lösung hält.
Das unterscheidet Bildung von Lernen. Güter lassen sich wägen und messen, aber Werte muss man erlebt haben. Auf Unterrichtseinheiten kann man es nicht verteilen, und methodischer Fleiß würde nur stören, denn er verengt das Wahrnehmungsfeld. Darstellbar ist es nicht als Argument und Kalkül, sondern in Bildern und Geschichten. Es erschließt sich nicht durch Analyse, sondern durch Betrachtung. Als die Hingabe an das Unbestimmte steht sie dem Spiel näher als der Arbeit. Sie ist der „ästhetische Zustand“.
Bei aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht. Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
Wann ‚erziehen’ Eltern? Die Frage taugt als Vorlage für ein Schmunzelbuch. Zweifellos doch, wenn sie belohnen oder strafen: denn das tun sie ja wohl vorsätzlich. Was lernen ihre Kinder dabei? Nutzen und Schaden abwägen. Das würden sie aber auch ohne dies lernen – vielleicht langsamer, vielleicht schneller. Gerade dafür ist Erziehen also nicht ‚notwendig’.
Tatsächlich geschieht das, was ein unbeteiligter Betrachter Belohnung oder Strafe nennt, im täglichen familiären Kuddelmuddel nicht vorsätzlich, sondern nebenher, ohne Kalkül. Das ist die Regel, die von Ausnahmen bestätigt wird – welche ihrerseits nur deshalb wirken, weil sie Ausnahmen sind. Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig, unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A und B an C zu schaffen machen.
Die pädagogische Situation
Einen allgemeinen Begriff von Pädagogik – oder einen Begriff von Allgemeiner Pädagogik – kann es nicht geben. Was es gibt, ist ein allgemeines Bild von der pädagogischen Situation. Nämlich: Einer, der in der Welt schon zuhause ist, begegnet einem, der dort neu ist, und ist er ein anständiger Kerl, dann zeigt er sie ihm. Darin liegt keinerlei Notwendigkeit, die in Begriffen, Gesetzen oder Formeln darstellbar wäre. Es ist nur eben tatsächlich so. Die Menschen neigen dazu – weil der Neue in diesem Bild typischerweise ein Kind ist.
Wer mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen. Wie gut er sich aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bisschen neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben ‚meiner’ Welt scheint.
Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom pädagogischem Eros umschrieben wurde. Im Alltag gelingt es umso eher, je näher Menschen einander stehen. Darum sind Eltern in der Regel die besseren Pädagogen. Normalisieren können sie nicht so gut, aber was ihrer Welt an schulischer Breite fehlt, überbieten sie an anschaulicher Tiefe. Sie sind Alltagskünstler (wenn auch vielleicht nicht alle.)
Performing artist
Man kann immer noch einen Beruf daraus machen. Aber weil Normalität kein berechtigter Erziehungszweck mehr ist, ist das Labor nicht mehr der bevorzugte Ort. Erziehung findet in Situationen statt, und die sind immer konkret. Erziehen ist eine Sache des Alltags. Pädagogik ist, wo sie theoretisch ist, Kunstlehre. Und der – gute – Erzieher ist ein Künstler.
Aber ein Aktionskünstler: er schafft keine ‚Werke’, sondern eben nur – Situationen. Seine Sache ist es, die Situationen so zu arrangieren, dass sie den andern verlocken, (sich) heraus zu finden; nie vergessend, dass er selber mitspielt und dass vieles auch auf seinen Auftritt ankommt. Was es ist und wieviel es ist, wird er wissen, wenn er es probiert. Er ist kein Ingenieur, sondern ein Performer.
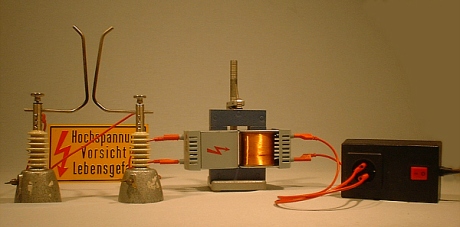
Andererseits ist die Philosophie aber auch eine Gesetzeswissenschaft, wenn auch eine problematische: Sie stellt fest, welche Regeln schlechterdings gelten – sofern überhaupt Etwas gelten soll.
Neunte Windung: Wissenschaft ist öffentliches Wissen, II.

Allgemein und notwendig: ist das eine additive Definition? Oder eine explikative (analytische: ‚zwei Seiten einer Medaille’)?!
Eben so: Nur ein Wissen, das sich als notwendig erweist, taugt dazu, allgemein zu werden. Dieser Prozess: ‚sich als notwendig erweisen’, heißt Reflexion/Kritik. Es ist die Verallgemeinerung dieses Prozesses, durch den Notwendigkeit sich erweist. Summa summarum: Wissenschaft ist öffentliches Wissen; im Unterschied zu privatem. Die Form ist in diesem Fall die Sache selbst. Oder: der historische Unterschied ist zugleich der logische.
Civil society essentially is public space. But public opinion, by its nature, is divided. Science is able to reduce that domain of dissent; it is public knowledge. Its apogee in modern times was the political event par excellence. Its coercive power resides in its systematic proceeding from assuring its logical foundation, to the conceptual seizure of its object.

Licht in dieses Mysterium hat Hermann Lotze gebracht. Er unterscheidet – Ei des Kolumbus – drei verschiedene Wirklichkeits- oder besser Gegebenheitsmodi: das (allbekannte) Sein, das (später so genannte) Erleben und das – erst von ihm zur Geltung gebrachte – Gelten. Von den so genannten Wahrheiten sagt er insbesondere: “Sie schweben nicht zwischen, außer oder über dem Seienden. Als Zusammen- hangsformen mannigfaltiger Zustände sind sie vorhanden nur in dem Denken eines Denkenden, indem es denkt, oder in dem Wirken eines Seienden in dem Augenblick seines Wirkens.” (Lotze, Mikrokosmos, III/2, 579)
Das war erst nur eine logisch formale Unterscheidung. Materi- allogisch gedacht, müsste es so heißen: Allererst ‚gegeben’ ist das Erleben selbst; ein Strom von Empfindungen, in dem Sinnliches, Logisches und ästhetisch-moralisch Werthaftes noch gänzlich ungeschieden als ein und dasselbe „in Erscheinung treten“.
Alles, was danach kommt, ist ein Arbeitsprodukt der Reflexion.
Die hundert Taler in meiner Vorstellung und die hundert Taler in meiner Tasche gelten gleich, wenn ich an ihnen eine Rechung – sagen wir: von Zins und Zinseszins – durchführe. Sie gelten ganz verschieden, wenn ich eine Schneiderrechnung bezahlen soll.
Mit ihrem Sein hat das durchaus zu tun – indem es nämlich in mein Dasein mal mehr, mal weniger eng verstrickt ist.

Wir nehmen keine Erscheinungen wahr. Wir nehmen keine Bedeutungen wahr. Wir nehmen Dieses oder Das wahr. Was ist Dies oder Das? Eine Erscheinung, die etwas bedeutet. Könnte sie mir nichts bedeuten, würde sie mir nicht erscheinen.
Die Unterscheidung geschieht nicht in der Anschauung, sondern in der Reflexion. Wahrnehmung ist das Produkt beider. Die Reflexion rechnet auf eine Bedeutung. Wenn sie keine erkennen kann, fragt sie; sogar, wenn sie döst. Reflexion ist Absicht.
In seiner Wirklichkeit ist unser Wahrnehmen kein linearer Ablauf in Stufenfolge – erst anschauen, dann reflektieren, dann wahrnehmen in specie; oder andersrum. Sondern, wie die zeitgenössische Hirnforschung nahelegt, ein systemischer Prozess “in Permanenz”. Es wird nicht erst diese, dann jene und schließlich eine dritte Hirnregion aktiv, sondern sie interagieren “apriori”; und sie warten regelrecht darauf, zu tun zu kriegen, sie suchen sich ihren Stoff. Darum spielt es auch keine Rolle, welche der jeweils beteiligten Regionen stammesgeschichtlich die ältere und welche die jüngere ist. Heute agieren sie allezeit uno actu als Ein Ganzes System.
So geschieht das Bewerten des unmittelbar durch die Sinnes- reize Gegebenen – was man das ‚ästhetische Erleben’ nennen könnte – gleichzeitig in mehreren Hirnarealen, insbesondere dem Limbischen System, das aus mehreren entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teilen besteht, und der als Gustatorischer Cortex bezeichneten ‚Inselrinde’, die in der entwicklungsgeschichtlich viel jüngeren Fissura Lateralis liegt. Und zugleich spielen in noch immer unverstandener Weise die Reaktionen des Plexus solaris hinein, der überhaupt nicht zum Zentralen System gehört, sondern aus einem Nervenknoten in der Bauchhöhle besteht – und insofern „uralt“ ist.
Wenn also Baumgarten seinerzeit das ästhetische Erleben als das „niedere“ Erkenntnisvermögen bezeichnet hat, war das in neurophysiologischer Hinsicht grundfalsch. Es spielt in die „höheren“ Erkenntnisvorgänge jederzeit hinein, so wie jene in diese.
Aber in philosophischer Hinsicht ist es diskutabel. Die Philosophie betrachtet das Wissen – als Inbegriff all unseres Gewärtigseins – nicht in seinem physiologischen oder psychologischen Vorkommen, sondern nach seinem logischen Aufbau. Logisch kommt von logos, und bezeichnet alles auf Sinn und Vernünftigkeit Bezogene (und nicht lediglich die Regeln des korrekten Schlussfolgerns). Zwar ist auch in logischer Hinsicht das Wissen (wenn es da ist) jederzeit ‚ganz und auf einmal’ da. Aber zugleich ist es ‚geworden’.
Allein in logischer Hinsicht folgt notwendig eines aus dem andern, nur in logischer Hinsicht gibt es ‚Begründung’ (und in der Naturwissenschaft wird die Vorstellung der Kausalität nur ‚sozusagen’ verwendet, zu heuristischen Zwecken). In logischer Hinsicht ‚gibt es’ also zuerst und danach. Da müssen die Sinnesreize zuerst ‚da’ sein, bevor sie ‚gemerkt’, und gemerkt werden, bevor die ‚gewertet’ werden können. Die logisch-genetische Betrachtung ist etwas anderes als die historisch-empirische.
Allerdings ist in logischer Hinsicht die Begründungskette umkehrbar (was sie in der Naturwissenschaft, wo Begründung nur ‚sozusagen’ vorkommt, nicht ist). Wenn das eine notwendig das andere zur Folge hat, dann hat das andere notwendig das eine als Grund. Mit andern Worten, der Schluss ‚begründet’ in logischer Hinsicht den Anfang ebenso, wie jener ihn. Stellen wir uns das Wissen als einen unbegrenzten Prozess vor – was es genetisch sicher ebenso ist wie historisch -, dann ist das wirkliche Wissen eine endlose Umbegründung alles wechselseitig Begründeten.
Das Gewärtigsein ist, wenn alles klappt, eine Revolution in Permanenz.
Dass alles klappt, ist in Ansehung unserer engen bürgerlichen Verhältnisse selten. Das ist schlecht für die Verhältnisse.
Zwölfte Windung: “Ich weiß”

Das allgemeine Ergebnis der Kritischen Philosophie lässt sich in diesem Satz zusammenfassen: Es gibt kein Wissen ohne Prämissen. In unserem wirklichen tagtäglichen Normalwissen gibt es tausendundeine Annahme über Tatsächliches. Diese lassen sich (prinzipiell) auf wissenschaftlichem (experimentellem + logisch spekulativen) Weg überprüfen. Ziehe ich alle diese faktologischen Wissenspartikel von meinem Wissen ab, so bleibt als Substrat immer noch übrig der Elementargestus „ich weiß“.
Ich weiß – das heißt, ich nehme an einem (mir irgendwie gegebenen) X irgend (-wie irgend-) einen Anteil. Sei es, dass es (zum Teil) Teil von mir, sei es, dass ich (zum Teil) Teil von ihm werde: Beides ist nicht zu unterscheiden; denn beides ist gleichermaßen (‚nur’) “im Wissen“.
Nahe liegt es, die Entstehung meines Wissens als einen Akt des Ergreifens aufzufassen. Aber das ist nur eine Metapher. Es könnte ebenso gut sein, dass sich das außer mir Seiende von außen meinem Wissen einprägt wie auf eine Tabula rasa. Das eine ist die idealistische, das andere die realistische Auffassung vom Weg der Erkenntnis. Beide gehen von verschiedenen Prämissen aus, beide können einander darum gegenseitig nicht am Zeug flicken, denn beide haben keinen gemeinsamen Grund, vor den sie ihre Argumente als deren Richter tragen könnten.
Wenn beide nur zwar einander nicht widerlegen können, heißt das dennoch nicht, dass einer so gut gelten könnte wie der andere. Denn der realistische Standpunkt – der mit den Eindrücken auf der Tabula rasa – kommt nie an den Punkt, wo er uns zeigen kann: Sieh her, hier wird aus dem einprägenden Akt des Gegenstandes ein Anblick von dem Gegenstand. Geschweige denn ein Anblick von dem Anblick! Die realistische Auffassung kann uns nicht nur nicht erklären, wie es zu einem Wissen von etwas – und mithin zu einem Wissen von Etwas – kommen kann, sondern schon gar nicht, wie es möglich ist, dass wir von diesem Wissen wissen.
 Wenn das Wissen
bloß ein Rezeptakel wäre, wo die Vernunft lediglich ‚vernimmt’ (wie J.
Fr. Herbart wortspielerte), wäre die Tatsache der Reflexion nie
und nimmer zu verstehen. Die Reflexion ist aber der springende Punkt
des Wissens, denn erst in ihr trennen sich Bild und Gegenstand und
Gegenstand und Subjekt von einander. Ohne sie gäbe es nur ein dumpfes Da!, wie es womöglich Tieren vorkommt – und selbst das wäre vielleicht schon zuviel gesagt.
Wenn das Wissen
bloß ein Rezeptakel wäre, wo die Vernunft lediglich ‚vernimmt’ (wie J.
Fr. Herbart wortspielerte), wäre die Tatsache der Reflexion nie
und nimmer zu verstehen. Die Reflexion ist aber der springende Punkt
des Wissens, denn erst in ihr trennen sich Bild und Gegenstand und
Gegenstand und Subjekt von einander. Ohne sie gäbe es nur ein dumpfes Da!, wie es womöglich Tieren vorkommt – und selbst das wäre vielleicht schon zuviel gesagt.
Die idealistische Auffassung des Wissensakts hat diese Sorge nicht. Und keineswegs hat sie es nötig, die Wirklichkeit der Dinge der Außenwelt irgend in Zweifel zu ziehen; denn das wäre eine metaphysische Frage, die ganz außerhalb ihres Gesichtskreises liegt. Das Wissen ist ein aktives Anteilnehmen, ein Zugreifen meiner auf das, was mir in Raum und Zeit begegnet. Dass es ist, lag vor meinem Zugreifen (darf ich annehmen, wenn ich es auch nicht wissen kann), aber wie und was es ist, „ereignet“ sich erst im Zugriff, nicht davor und nicht danach.
Man muss sich von der Vorstellung freimachen, dass in unserem Wissen die Sachen selbst vorkämen – Dinge, Tatachen, Sachverhalte, Zustände. In umserem Wissen sind immer nur die Bilder vorhanden, die wir uns von den Sachen – Dingen, Tatsachen, Sachverhalten, Zuständen – gemacht haben. Wir können uns immer nur darüber streiten, wessen Bilder schärfer, deutlicher oder für die Mitteilung brauchbarer sind – was sich immer erst im Vollzug entscheidet. Nicht können wir uns darüber streiten, wessen Bilder wahrer, authentischer, den Sachen adäquater sind – weil wir dafür keinen übergeordneten Maßstab haben; so wenig, dass wir nicht einmal angeben können, was mit solchen Formulierungen gemeint ist.
Mit anderen Worten, was “ich weiß”, muss sich immer erst noch bewähren – an den Sachen, wie sie im Meinungsverkehr vorkommen.
Wahr wäre also, was im tatsächlichen Verkehr einstweilen als wahr gilt – jusqu’à nouvel ordre? Gibt es also immer nur bedingte Wahrheit?
Na ja. Auch eine bedingte Wahrheit gilt nur insofern für wahr, als immerhin ihre Bedingung gilt. Tja, und so weiter… Ob nun fünf, fünftausend oder fünf Billionen über das Gelten dieser einen bestimmten Wahrheit sich einstweilen verständigt haben möchten – sie mussten doch immer (“irgendwie”) voraussetzen, dass irgend Etwas den empirisch, faktisch (“historisch”, sagt Fichte) bedingten Geltungen ungedingt zu Grunde liegt. Der Satz ‘alle Wahrheit ist relativ’ ist ein Unsatz. Entweder Wahrheit ist oder ist nicht.
Dass Wahrheit sei, ist die unvorgreifliche Prämisse allen Wissens.
________________________________________________________________

Ich kann das Gewicht einer Kartoffel nicht erfahren, wenn ich ein Metermaß anlege, und ihren Umfang nicht mit der Waage messen. Ich kann das eine nicht aus dem andern ableiten noch das eine ins andere umrechnen. Es sind zwei verschiedene Dimensionen, die aber nicht in der Kartoffel stecken – die ist immer ein und dieselbe -; sondern in der Eigenart meines Wahrnehmungsapparats.
Genau so sind Freiheit und Kausalität einander irreduzibel.
*
Die Kartoffel in diesem Bild ist der Mensch.
Wenn ich mich einmal entscheide, eine Sache durch die Augen der Naturwissenschaften anzuschauen, habe ich ipso facto mitentschieden, sie unters Gesetz der Kausalität zu fassen: beides ist dasselbe. Habe ich einen Gegenstand mit den Augen, das heißt den Messinstrumenten der Naturwissenschaften angeschaut, kann es nicht ausbleiben, dass ich ihn als einen Gegenstand der Naturwissenschaft erkenne. Jenes folgt aus diesem, und nicht umgekehrt.
Die Knolle Mensch muss ich aber nicht als einen Gegenstand der Naturwissenschaft anschauen. Ich kann sie – nur sie – auch als den Gegenstand der Geschichtsschreibung ansehen: als ein Wesen, das Geschichte hat, weil es sie macht. Andernfalls würde es die Frage nach dem freien Willen gar nicht geben. Stammt sie etwa aus der Naturwissenschaft? Da kommt sie nicht her, da gehört sie nicht hin.
Nur wer sagt, der Mensch ist in seinen Willensentscheidungen frei, kann auch sagen, dass er in der Welt etwas tun soll. Ist alles determiniert, dann haben die Recht, die schon immer gesagt haben, man kann nix machen. Gemeint war jedes Mal: Ich brauch’ nix machen. Bevor Freiheit und Determination ein Problem der Geschichtswissenschaft werden können, sind sie eine politische Frage.
Freilich ist dieses Problem längst gelöst. Die endgültige Antwort heißt: Die Menschen machen ihre Geschichte selber, aber sie machen sie nicht unter frei gewählten Bedingungen; und stammt von Karl Marx. Die nicht frei wählbaren Bedingungen sind für der Geschichtsschreibung das, was für die Naturwissenschaft die determinierenden Faktoren sind. Für eine ‚verstehende’ Geschichtswissenschaft (wie Max Weber sie nennt) treten die Bedingungen des Handelns in den Motiven der Handelnden wieder auf: als deren Triebkraft. Aber nicht als deren Richtung. Die muss der freie Wille, politischer Verstand oder Unverstand, ex sponte hinzufügen.
*
Mögen die Psychologen die Triebkraft der Motive zur Natur rechnen: Der Philosoph wird den Willen immer zum Geist zählen (was auch sonst?).
_____________________________________________

Der Entschluss, Naturwissenschaft zu betreiben, und der Entschluss, alles, was erscheint, als Einzelfall eines Gesetzes anzusehen, sind ein und dasselbe. Denn durch diesen Entschluss Galileo Galileis wurden die Naturwissenschaften begründet.
Die Grundform des Naturgesetzes ist das Kausalprinzip. Es bedeutet, alles, was ist, als ein Ereignis aufzufassen, das mit Notwendigkeit aus einem vorangegangenen Ereignis folgt. Dieses Prinzip ist nicht aus der Forschung gewonnen, sondern liegt ihm zu Grunde. Es ist eine heuristische, „regulative“ Annahme, durch die Forschung erst möglich wird. Dass sie sich im Verlauf der Forschung bewährt, macht den Erfolg der Forschung überhaupt erst aus: Die Natur der Wissenschaft ist definiert als das Reich, wo Kausalität herrscht. Es ist eine Petitio principii. Wenn etwa die Hirnphysiologie findet, dass ein freier Wille nicht statt hat, holt sie aus ihrer Forschung nur heraus, was sie vorab hineingetan hat.
Solange sie es dabei bewenden lässt, ist alles in Ordnung. Wenn sie aber aus einem regulativen Prinzip ein konstitutives Prinzip macht, betreibt sie Metaphysik und verlässt den Boden der Naturwissenschaft.
Das Kausalprinzip ist kein Fund der Wissenschaft, sondern ein Selektionsprodukt der Lebenswelt. Es beruht auf der im Laufe einer millionenjährigen Gattungsgeschichte angehäuften Erfahrung, dass ich, wenn ich einen noch nicht vorhandenen Zustand wünsche, zu dem vorhandenen Zustand etwas hinzufügen muss, nämlich einen Akt. Ich muss wirken.
Die Urform des Kausalprinzips ist der Animismus. Nämlich die Annahme, dass alle Dinge, die mir begegnen, so sind (und selbst, dass sie sind), weil sie es wollen. Sie wirken, weil sie so wirken wollen. Eine Unterscheidung zwischen ‚zufälligen’ und ‚notwendigen’ Ereignissen ist noch gar nicht möglich, denn zu jedem unerwarteten Ereignis kann ein noch unbekanntes beseeltes Subjekt hinzugedacht werden.
Doch die Erfahrung lehrt, dass viele Ereignisse sich vorhersehen lassen, und einige eben nicht. Der Mythos löst diesen Widerpruch, indem er an die Stelle der ganz individuellen immer allgemeinere Subjekte setzt. Gottheiten und Dämonen sorgen für Regelmäßigkeiten, von denen sie willkürlich abweichen können. Nicht mehr die Dinge selber wirken, sondern werden bewirkt. Und so der Mensch.
Die Form des Mythos ist die (positive) Erzählung, nicht die (fragende) Untersuchung. Man muss ihn glauben, fürs Wissen ist er ungeeignet. Die Fragen fernzuhalten ist sein eigentlicher Zweck. Die mythische Epoche ging unter mit dem Aufkommen der griechischen Philosophie. Ist das, was erscheint, so wie es ist, oder ist es in Wahrheit etwas anderes? Es beginnt das Zweifeln.
Es gibt nichts als Schein, meint Heraklit von Ephesos, und Parmenides von Elea entgegnet: Nur was erscheint, ist Schein; das Wahre ist nicht sichtbar, sondern nur dem Denken zugänglich. Ist oder ist nicht; Werden ist Täuschung. Der eine verneinte die Notwendigkeit, der Andere den Zufall. Hier griff Platos Ideen-Lehre ein. Die Ideen lagen nunmehr jeweils einer ganzen Klasse von Ereignissen zugrunde, sie waren ‚vor’ den Göttern auf dem Olymp. Sie waren das eigentlich Sein. Das Werden, das wir auf der Erde beobachten, ist uneigentlich, es ist das Wirken des Wahren in der Erscheinung. Zufall ist nur Schein, und doch die Erscheinungsweise des Notwendigen. Wissen – im Unterscheid zu bloßem Meinen – ist: im Zufälligen das Notwendige ergründen.
Aristoteles’ Gedanke der Entelechien, deren jede ihr Entwicklungsgesetz ganz allein in sich trägt, war demgegenüber ein Rückgriff auf animistische Vorstellungen. Er behinderte die Ausbildung einer systematischen Forschung so lange, bis Galileo Platos Ideenlehre umformte in die Lehre von allgemeinen Naturgesetzen. Seither ist eine Kausalbetrachtung möglich und experimentell bewährte Wissenschaft.
Ein Gesetz muss gesetzt worden sein. Die Vorstellung von einem Schöpfergott wird nötig – ein unbegründeter Grund, causa sui, ein unbewegter Beweger. Kein Problem für die Theologie, aber unbefriedigend für den Forscher. Wenn Gott die Naturgesetze erlassen hat – ist er ihnen dann selber unterworfen? Dann wäre er nicht länger Gott. Er hätte am Anfang lediglich einen Fingerschnipp, une chiquenaude getan, um die Maschine in Bewegung zu setzen, dann setzte er sich zur Ruhe. So spöttelte Blaise Pascal über das ‚System’ des Descartes.[*]
Spinoza hat es radikal gelöst: Gott ist selber Naturgesetz, deus sive natura. Das ist im Wesentlichen Stand der Wissenschaft. Die Annahme, die Naturgesetze seien im Urknall erst entstandenen, macht lediglich den Urknall selbst zur causa sui. Alles bleibt im Rahmen des Gesetzes von Ursache und Wirkung, und auf dem Boden der Wissenschaft. Denn das Kausalprinzip reicht immer nur bis ganz dicht an den Urknall heran und nicht in ihn hinein und schon gar nicht hinter ihn zurück. Die Frage, was vor dem Urknall war, entzieht sich der Kausalbetrachtung und gehört nicht zur Naturwissenschaft. Man mag sie spekulativ und experimentell in mythischen Bildern behandeln, und sie dann nach ihrer Plausibilität bewerten. Aber positiv erforschen lässt sich da nichts.
Und jedem Wissenschaftler steht es frei, den Urknall selbst für den Sitz des Schöpfergottes zu halten – solange er das privat für sich tut und nicht die Öffentlichkeit damit behelligt.
*
Bleibt eines hinzu zu fügen. Niemand ist gehalten, die ganze Welt naturwissenschaftlich zu betrachten. Das tut auch der Naturwissenschaftler nicht, denn damit würde er nicht einen Tag im wirklichen Leben überstehen. Naturwissenschaftlich denkt er im Labor, nur da ist es am Platz.
[*] …das Malebranche daher um die Zutat ergänzte, dass Gott die Freiheit bleibt‚ ’bei Gelegenheit’ immer wieder mal steuernd einzugreifen – womit aller Wissenschaft der Garaus gemacht ist.
Dabei war die Philosophie lange von ihrem Weg abgekommen. Wenn der Mensch als Teil eines sinnvoll geordneten Kosmos angesehen wird, dann wird wohl der Sinn jener Ordnung des Ganzen auch dessen Teile durchdringen, so musste es scheinen. Die umfassende Einsicht in die Gesetze der Natur würde mir die Stelle anweisen, wo ich hin gehöre; und wer und was ich bin, würde darüber bestimmen, was ich in der Welt soll. Meine Freiheit beschränkte sich dann auf meine Einsicht in die Notwendigkeiten.
Das kann dem Menschen nicht genügen, und darum fand er auch bald den Fehler darin: Er ist nicht nur Objekt der Naturgesetze, sondern auch Subjekt seines Wollens. Seine Freiheit in einer objektiven Welt von Zufällen und Notwendigkeiten mag nur eine ganz kleine sein; aber sie ist es, worauf es ihm ankommt.
Die Kritische oder Transzendentalphilosophie hat dem wissenschaftlichen Denken gezeigt, bis wo es reicht. Was wahr ist, kann sie nur kritisch prüfen. Positiv herleiten kann sie es nicht. Dass ‘es Wahrheit gibt’, ist zwar seine unverzichtbare Prämisse, aber es muss vorausgesetzt werden und lässt sich nicht nachweisen. So weit sie selber Wissenschaft ist, kann die Philosophie auf die Frage nach dem rechten Leben, die sie doch hervor-gerufen hatte, gerade nicht antworten.
Allerdings kann sie, gerade weil sie Wissenschaft ist, zeigen, was unter den zahllosen Sinn-Angeboten, die schon immer auf den Märkten gewimmelt haben, der Kritik nicht standhält und als Scharlatanerie und Bauernfängerei zum Tempel hinaus gepeitscht gehört.
Insofern hat die wissenschaftliche Philosophie ihr Geschäft noch lange nicht erledigt. Je mehr Weisheitschulen auf dem öffentlichen Platz sich tummeln und um die Gunst des Publikums buhlen, um so mehr bekommt sie zu tun. Ihr “praktischer” Teil geht überhaupt erst richtig los!
___________________________________________________
Erste Windung
- Die praktische Philosophie beginnt da, wo die theoretische nicht weiterkann.Zweite Windung
- Natur- und… “Geistes”wissenschaft?Dritte Windung
- Wissenschaft von der Politik?Vierte Windung
- Philosophie oder Psychologie?Fünfte Windung
- “Erziehungswissenschaft”, oder Die Standesideologie der pädagogischen ZunftSechste Windung
- Ethik und Ästhetik sind eins.Siebente Windung
- Eine AlltagskunstAchte Windung
- Ist Philosophie eine Geisteswissenschaft?Neunte Windung
- Wissenschaft ist öffentliches Wissen; zum zweiten.Zehnte Windung
- Sein und Gelten.Elfte Windung
- Gewärtigkeit; eine Revolution in PermanenzZwölfte Windung
- “Ich weiß”Dreizehnte Windung
- Geist und Materie, oder: Natur und GeschichteVierzehnte Windung
- Die Naturgeschichte des Kausalitätsprinzips________________________________________
Erste Windung: Die praktische Philosophie beginnt da, wo die theoretische nicht weiterkann

Gedanklich endet meine Wendeltreppe bei den Ergebnissen der ‘kritischen’ alias Transzendentalphilosophie. Das wurde beanstandet, denn danach hat die Zahl der philosophischen Bücher wohl noch um ein Vielfaches zugenommen…
Ich wollte aber keinen kurzen Lehrgang durch die Geschichte der Philosophie schreiben, sondern ein Einführung ins Philosophieren selbst. Ich meine im Ernst, dass der theoretischen Philosophie seit den Tagen der Transzendentalphilosophen substanziell nicht mehr viel hinzugefügt wurde. Wo es theoretischen Erkenntnisgewinn gab, handelte es sich weitgehend um die – philologische – Klärung von Missverständnissen. Wo die ‚Phänomenologie’ – Husserl und, in seinem Gefolge, Heidegger – zu brauchbaren Resultaten kommt, bestätigt sie doch immer nur, in weniger deutlichen Begriffen, die Ergebnisse der ‚kritischen’ alias Transzendentalphilosophie. Ich bin so kühn, mutatis mutandis dasselbe über die ‚sprachanalytisch’-pragmatische Schule unserer Tage zu behaupten.
Der Umkreis der philosophischen Themen ist im großen Ganzen abgesteckt. Innerhalb des Kreises mag das Feld immer und immer wieder neu bearbeitet und mögen den Themen immer wieder neue ‘Seiten’ abgewonnen oder das Gewonnene aus anderer Perspektive neu bestätigt werden. Tatsächlich ist die Philosophie seither so verfahren; soweit sie nämlich theoretisch und wissenschaftlich ist.
Doch hat sich seit dem 19. Jahrhundert, nämlich seit Schopenhauer und Kierkegaard eine Variante der Philosophie ausgebildet, die ausdrücklich nicht theoretisch und auch nicht wissenschaftlich sein will, die Lebensphilosophie. Ihren bislang wort- und gedankenmächtigsten Vertreter hat sie in Nietzsche gefunden. Ihr Ehrgeiz ist es, die Frage nach dem Sinn des Lebens unmittelbar und positiv aufzuwerfen und nicht länger über den Umweg metaphysischer Begriffsakrobatik. Philosophie soll praktische Lebenshilfe geben (und womöglich politisch wirksam werden). Damit ist sie im öffentlichen Leben so erfolgreich gewesen, dass sie im landläufigen Verständnis den Begriff der Philosophie ganz für sich vereinnahmt und die wissenschaftliche Philosophie in die akademische Ecke gedrängt hat.*
Ihr Publikumserfolg ist verständlich. Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich jedem Menschen. Und jeder stellt sich ihr – mal mehr, mal weniger bewusst. Was er dabei – auf sein Leben zurückblickend – jeweils an Antworten gefunden zu haben meint, das kann man Lebensweisheit nennen. Nichts steht ihm freier als das. Es fragt sich nur, ob sich daraus eine positive Lehre entwickeln lässt, die der eine dem andern mit einem Anspruch auf öffentliche Verbindlichkeit vortragen darf.
*
Die
Frage nach dem Sinn (des Lebens in) der Welt war der Urheber der
Philosophie – und, durch sie, der Wissenschaft (die eine spezifisch
abendländische Erscheinung ist). Das war der Ausgangspunkt und war der
Schlusspunkt meiner “Wendeltreppe”. Die ständige metaphysische
Versuchung unseres Verstandes – das, was Kant den “dialektischen Schein”
genannt hat – ist es, in der Erkenntnis des Seienden einen Hinweis auf
unser Sollen, auf die ‘rechte Lebensführung’ zu suchen. Wenn
der Einzelne Bestandteil eines sinnhaft geordneten Kosmos ist, dann
liegt es nahe, dem Teil dasselbe Ordnungsprinzip zu zu weisen wie dem
Ganzen. ‘Was der Mensch soll’ ließe sich geradlinig aus dem, ‘wie die
Welt beschaffen ist’, herauslesen.
Doch die Erkenntnis des Seienden ist zirkulär und führt nirgends hin: ‘Die
Natur’ antwortet uns ja immer nur auf die Fragen, die wir ihr stellen –
und auch das nur unter Stöhnen und Seufzen. ‘Der Naturwissenschaft- ler
beobachtet keines Wegs ‚die Natur’ so lange, bis sie ihm von allein ein
Lied singt. Vielmehr reißt er aus der Natur vorsätzlich ein winziges
Stück heraus, zwingt es in die Folterkammer seines Labors
und quält es kunstvoll so lange, bis es auf seine gezielten Fragen mit
Ja oder Nein antwortet.’ Den „Sinn“ der Sachen – das, „worum es [uns] eigentlich
geht“ – haben wir, als Frage, immer schon selber mitgebracht, und wenn
wir ihn hernach ‚an’ den Sachen wieder erkennen, dann ist es nur der
Schatten unserer „apriorischen“ Absicht. ‚Die Natur’ kann uns nicht
einmal sagen, wer oder was sie ‚ist’. Noch weniger kann sie wissen, was wir in einer Welt ‚sollen’, die längst mehr geworden ist als bloß Natur.
Die Kritik an diesem Irrtum ist dasjenige, was an der Philosophie wissenschaftlich ist.
Oder anders, wissenschaftlich ist die Philosophie nur als Kritik. Wenn ich sage, man kann leben, ohne zu philosophieren, dann heißt das: Man kann leben, ohne Wissenschaft zu treiben. Um das Wort Philosophie – und wer es alles für sich in Anspruch nehmen darf – muss man sich nicht streiten. Auch die Philosophischen Lebensberatungs-Dienste unserer Tage dürfen sich so nennen, gesetzlich geschützt ist das Warenzeichen nicht. Aber ich bestehe auf einer scharfen Unterscheidung zwischen kritischer, wissenschaftlicher Philosophie und landläufiger Lebensweisheit.
Das ist eine politische Erfordernis.
Wissenschaft ist öffentliches Wissen. Sie ist entstanden, um in der Öffentlichkeit ein Feld abzustecken, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten, die immer auch von Interessen geprägt sind, vernünftiger Weise nicht mehr möglich sind. Dies ist ihr historischer Sinn. Das Aufkommen der Wissenschaften im Abendland des siebzehnten, achtzehnten Jahrhunderts war das politische Weltereignis. Herrschaft konnte von nun an gemessen werden an dem, was ‘als vernünftig erkannt’ war. Und nur so ist eine repräsentative, nämlich die Staatsbürger repräsentierende politische Ordnung überhaupt denkbar. Die Öffentlichkeit erwartet allerdings von der Wissenschaft, dass sie Gesetzestafeln erstellt, in die man die ‘konkreten Fälle’ nur noch einzutragen braucht, um die ‘richtige Lösung’ sogleich ablesen zu können. Es liegt daher im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Wissenschaft selbst, ihre Grenzen möglichst scharf zu ziehen.
Der einzig begründete Ausgangspunkt der praktischen Philosophie ist ein negativer: dass die theoretische Philosophie – nach den Ergebnissen der ‚Kritik’ – im Sein keinen Sinn nachweisen kann. Der Sinn ist das, was — nicht durch Notwendigkeit vorgegeben ist, sondern: – ‚durch Freiheit möglich’ wäre. Sinn kann man nicht finden, sondern muss man erfinden.
Ist er also beliebig?
Na ja. Jedenfalls nicht in dem ‚Sinn’, dass erlaubt ist, was einem grade ‚in den Sinn kommt’. Denn was aus Freiheit geschah, lässt sich zwar nicht ‚begründen’, nämlich aus theoretischen Einsichten herleiten; aber man wird es rechtfertigen müssen, nämlich vor mir selber und dann vor all denen, denen ich ihrerseits Freiheit zumute und denen ich über den Weg laufe. Dann wird man sehen…
Mit andern Worten: Würde ich nicht in einer Welt leben, die ich ‚in Freiheit’ mit Andern teile, bräuchte ich keine praktische Philosophie und keine ‚Sinn des Lebens’. Ich lebte vor mich hin, und damit gut.
*
Zwar kann die Wissenschaft (mit jedem Tag genauer) sagen, ‘was ist’. Denn das ist die theoretische Frage, die in ihr Ressort fällt. Aber was wer soll, ist eine praktische Frage, die nicht nach wahr oder falsch, sondern nach gut oder schlecht zu entscheiden ist. Und die fällt eben nicht in ihr Ressort: Denn gegenüber den Fragen des praktischen Lebens verhält sie sich, das sie theoretisch ist, rein kritisch: indem sie sagt, was nicht ist. Die Frage, wie und wohin ich mein Leben führe, ist ein praktische Frage; und eine private. Die Wissenschaft kann mir sagen, ob es good vibrations gibt, auf die ich rechnen darf, oder nicht; danach muss ich selber entscheiden.
Die Frage, wohin die Staaten und die Gesellschaften steuern, ist öffentlich, aber sie ist nur in Grenzen theoretisch. Denn Antwort hängt von denen ab, die sie stellen, und die sind Handelnde, bevor sie wissenschaftlich Erkennende sind; darum läuft die wissenschaftliche Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit immer hinterher und bringt es allenfalls zur self-fulfilling prophecy**. Und dabei ist die Frage, wohin sie steuern sollen, noch nicht einmal angeschnitten. Könnten die Gesellschaftswissenschaften wirklich voaussagen: Wenn ihr dies tut, geschieht das, und wenn ihr jenes tut, dann geschieht solches – dann müsste die Frage, ob wir ‘das’ oder lieber ’solches’ wollen, immer noch praktisch entschieden werden; ‘aus Freiheit’, wie Kant das nennt. So gibt es ein unmittelbares politische Interesse daran, dass sich die Wissenschaften ihrer Grenzen jederzeit klar bewusst bleiben; Hirnforschung incl.
*
Lebensweisheit ist dagegen eine Privatangelegenheit und gehört in “meine Welt”, wenn ich so sagen darf. Erstens geht sie nur mich selber an. Wenn ich zweitens darüber hinaus einen Drang spüre, meine Anschauungen (!) andern mitzuteilen, dann stehen mir dazu die Mittel der nicht-diskursiven Mitteilung zu Gebot; die Mittel der Kunst nämlich. Philosophie könne man eigentlich nur noch dichten, meinte Wittgenstein...
Die
Kritik führt bis zu diesem Punkt: Damit überhaupt etwas gelten kann,
muss ein Absolutum gelten. Aber wir (die Wissenschaften) können euch
nicht bis dort hin führen. Begründen können wir das Absolute nicht. Wenn
wir an jener Stelle sind, müsst ihr selber springen – auf eigne Faust;
und mögt euch hinterher rechtfertigen. Nämlich vor euch selber und
denen, die in euerm Privatleben sonst noch vorkommen.
Wer künstlerische Berufung fühlt, der trete vors große Publikum. Der Kritik ist er dort freilich nicht entzogen, ganz im Gegenteil. Nur ist es jetzt die Kunstkritik – die umso unerbittlicher ist, als sie selber Teil des kritisierten Gegenstandes ist. Die Kunst hat sich im Laufe der Neuzeit wie die Wissenschaft zu einer gesellschaftlichen Instanz entwickelt, und die Kritik ist deren Teil. Wissenschaftlich ist sie nicht, sondern ästhetisch. Sie kan nicht (logisch) demonstrieren, sondern nur (anschaulich) zeigen. Sie kann – wie die Kunst selber – Beifall heischen, aber kein Einverständnis erzwingen, wie die Wissenschaft.
*
Das gilt im selben Maß von den praktischen Staats- und Gesellschaftslehren. Die wissenschaftliche Kritik kann ihnen ihre Grenzen zeigen – und dass sie nicht Fleisch von ihrem Fleisch sind. Sie selber haben sich der Öffentlichkeit möglichst anschaulich darzustellen. Sie fordern zu Wertentscheidungen heraus, und die sind – in weitestem Sinn – ein ästhetischer Akt. Doch das Ästhetische liegt nicht jenseits der Vernunft, sondern diesseits. Es liegt ihr zu Grunde.
.
________________________________________________________________________
*) In derselben Zeit beobachten wir in der Kunst die Scheidung zwischen dem ernsten und dem unterhaltenden Genre. Crossover ist auch da eine ständige Versuchung.
**) In einer UFA-Komödie sagt Grete Weiser: “Wie soll ich wissen, was ich meine, bevor ich höre, was ich sage?” So geht es ‘der Gesellschaft’, wenn sie sich nach den Zielen ihres Handelns fragt. Wie können wir wissen, was wir wollen, bevor wir sehen, was wir tun?
Zweite Windung: Natur- und… “Geistes”wissenschaft?
Also soweit Philosophie wissenschaftlich ist, bleibt sie negativ und rein kritisch – das war das bisherige Ergebnis.
Will sie positiv und praktisch werden, kann sie sich an logische
Demonstrationen und Herleitungen aus geprüften Gründen nicht länger
halten. Sie muss postulieren, was “sein soll”, auf eigene Verantwortung und ohne Sicherheitsnetz. So in Politik und Pädagogik, und in der persönlichen Lebenslehre sowieso. Existenzphilosophie hat man das genannt, und der Namen gefällt mir. Positiv und wissenschaftlich verfahren allein die Naturwissenschaften, und darum nennen sie sich die exakten.
.
Und
was wird aus dem vielen, vielen positiven Wissen, das die Menschen
inzwischen über sich selbst und über ihr Tun und Lassen in Geschichte
und Gegenwart angesammelt haben? Dass es nicht ‘wissenschaftlich’ im
Sinn der strengen Verfahren von Physik und Chemie ist; dass es nämlich
nicht die Mathematik zum Leitfaden hat, springt ins Auge. Aber es ist doch nicht willkürlich und rein ästhetisch wie die von A bis Z wertsetzenden – und daher ‘durch Freiheit möglichen’ – praktischen Disziplinen. Sie hat es ja mit Erfahrungstatsachen zu tun!
Es fängt bei der Namensgebung an. “Natur”wissenschaft… im Unterschied, im Gegensatz zu was? Zu Geisteswissenschaft, Moral science, Humaniora? Der Unterschied ist nicht selbstverständlich, und darum wurde er auch nicht immer gemacht. Bei den Antiken erscheinen Physik und ‘Meta’-Physik noch ganz ungescheiden, erst bei Aristoteles werden sie wenigstens auf verschiedene Bände verteilt; aber schon bei den – dann lange Zeit Ton angebenden – Neuplatonikern (Plotin, Proklos) treten sie wieder vermengt auf. Sachlich notwendig wird sie auch wirklich erst mit Galileo, der mit der Mathematisierung der Formeln zuerst ein Kriterium eingeführt hat, um ’strenge’ Wissenschaft von mehr oder minder plausiblem Dafürhalten zu unterscheiden. Mit Descartes ist dieses Kriterium fürs Abendland verbindlich geworden: Wissenschaft spricht wahr, und der Maßstab für die Wahrheit der Aussagen ist, dass sie ’so klar und eindeutig bewiesen werden können wie die Demonstrationen der Geometrie’. Nur was sich in einem mathematischen Modell darstellen lässt, lässt sich mit mathematischer Sicherheit beweisen.
Dass ‘Natur’ eo ipso in ein mathematisches Modell gehört, war damit stillschweigend unterstellt. Die Unterstellung ist geschehen, indem sich Galileo ausdrücklich aus der aristotelischen Meta-Physik zurück besann auf Platos ‘Ideen’-Begriff und seiner Anschauung der reinen Formen (’vollkommene Körper’) in der Mathematik. Dass damit ‘allein die Natur’ zu erfassen wäre, war damit noch gar nicht positiv gesetzt. Es ergab sich negativ, indem ein Rest übrig blieb, der sich nicht in mathematischen Modellen darstellen lässt; eben die ‘nicht-exakten’ Wissenschaften: Wissenschaften im eingeschränkten Sinn…
Descartes hat schon zu seiner Zeit energischen Widerspruch gefunden, der zu seiner Zeit aber ungehört blieb. Giambattista Vico stellte der Idee von der mathematischen Durchschaubarkeit von Gottes Schöpfung den Grundsatz entgegen, dass einer nur das ‘wahr’ erkennen könne, was er selber gemacht habe: “Verum et factum convertuntur”, ‘wahr’ und ‘gemacht’ bedeuten dasselbe. Die Natur habe Gott gemacht und der allein könne sie erkennen. Der Mensch hat seine Geschichte (seine Kultur, seine Kunst…) gemacht, und die allein könne er verstehen.
In einen Gegensatz sind Physik und Philosophie mit dem Beginn der industriellen Revolution faktisch getreten. Es war ein Streit um die Deutungshoheit im gesellschaftlichen Raum, den die Philosophie ab Mitte des 19. Jahrhunderts nur verlieren konnte. Der Rückgriff auf G.Vicos Gedanken erfolgte gegen Ende des Jahrhunderts, als Philosophie und Geschichtswissenschaft gegen den bloßen Positivismus der ‘Natur’- und Ingenieurswissenschaften neu zu behaupten suchten.
Eine positive Bestimmung hat dann wohl zuerst Wilhelm Dilthey (1833-1911) unternommen. Während der Mensch im ersten Fall ‘die Natur außer ihm’ untersucht, betrachtet er in den “Geistes”-Wissenschaften ’sich selbst und seine Werke’. Gilt es bei jenen, die Dinge aus ihren Ursachen zu erklären, suchen diese, die Taten den Menschen aus ihren Motiven zu verstehen. Die Methode hier ist rationale Rekonstruktion, dort intuitive Einfühlung.
Das ist früh als unbefriedigend empfunden worden. Plausibel und für die Konversation tauglich ist es wohl, aber sobald man sich den wissenschaftlichen Grenzfällen nähert – für die die Unterscheidung ja taugen soll, nicht aber für die unstrittigen Fälle! -, lässt sie sich nicht konsequent durchführen. Generell schon darum nicht, weil seit Kant (von dem auch Dilthey ausging) auch in den Naturwissenschaften das menschliche Apriori – die ‘Kategorien’ und die ‘transzendentalen Anschauungsformen’ Raum und Zeit – immer schon mit enthalten ist. Und im Besondern wird es deutlich bei der immanenten Methodenreflexion der Naturwissenschaften: Beschäftigt sich Wissenschaftslogik mit der Natur außer uns oder mit uns selbst und unsern Werken?! Gänzlich verwirrend wird es beim Prüfstein der Naturwissenschaftlichkeit selber: der Mathematik – und da verstrickte uns diese Unterscheidung unversehens tief in die Metaphysik, und die Katze bisse sich in den Schwanz.
Wilhelm Windelband (1848-1915) sah es als irreführend an, die beiden großen Wissenszweige nach ihren Gegenständen unterscheiden zu wollen: Es stecken viel zu viele Prämissen da schon drin! Zweckmäßiger sei es, zunächst ihre Verfahrensweise und eo ipso ihre Erkenntnisabsichten zu unterscheiden: Die ‘Gegenstände’ werden sich finden…
Es gibt Wissenszweige, die in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen nach durchgehenden Regelmäßigkeiten suchen, und wenn sie sie finden, stellen sie sie womöglich in mathematischen Formeln dar. Diese nennen sie ‘Naturgesetze’. Wissen- schaften, die sich um die Formulierung von
Gesetzen bemühen, nennt er ‘nomothetisch’ (von gr. nómos= Gesetz, und thésis=Setzung). Es
gibt andere Wissenszweige, in denen es um die möglichst vollständige
Beschreibung einer einzelnen Gegebenheit geht (die notabene zu diesem
Zweck als eine ‘Einheit’ alias ‘Ganzes’ gedacht werden muss). Diese
Wissenschaften nennt er ‘idiographisch’ (von gr. ídion= dieses-Eine, und gráphê=Zeichnung).
Man solle daher nicht sagen: Die Geschichtswissenschaft (Gesellschafts-, Literatur-, Sprachwissenschaft…) “ist” idiographisch, “weil” ihr Gegenstand nichts anderes zulässt und man sich bescheiden muss, immer nur ein historisch eingrenzbares Einzelnes nach allen seinen Seiten auszuleuchten. Man kann auch immer auf diesen Feldern quer durch die Geschichte hindurch nach ‘Gesetzmäßigkeiten’ suchen. Freilich wird man ihr Vorhandensein nun nicht mehr arglos voraus setzen können. Und hat man faktische Regelmäßigkeit (=Wahrscheinlichkeiten) wirklich aufgefunden, wird man immer noch begreiflich machen müssen, was daran notwendig gewesen sein mag
Im übrigen ist es nicht das Fehlen einer gesetzgeberischen Prätention, die die idiographische Disziplinen weniger exakt macht als ihre ‘naur’wissenschaftliche Schwestern; das macht sie im Gegenteil weniger spekulativ. Sondern dass sie ihre theoretischen Vermutungen nicht an überprüfbaren Experimenten öffenbtlich bewahrheiten kann. Das Gedankenexperiment muss ihnen den Laborversuch ersetzen, und das ist weniger exakt als die Versuchsanordnung; denn Denkfehler sind ansteckend.
Kurz gesagt: Im Unterscheid zu Diltheys dogmatischer Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften ist Windelbands Unterscheidung von nomothetischen und idiographischen Disziplinen eine heuristische und daher kritische Bestimmung.
Und eins ist klar: Was die letzten Endes alles entscheidende Frage angeht, was der Mensch in der Welt soll – da bringen sie uns, wie wissenschaftlich auch immer, nicht einen Fuß breit weiter als ihre naturwissenschaftlichen großen Brüder. Denn was der Mensch in seiner Geschichte schon so alles gemacht hat, das “beweist” lediglich, welche Möglichkeiten er wirklich hatte, denn er hat sie ja ergriffen. Welche andern Möglichkeiten er vielleicht auchnoch gehabt hätte, aber eben nur nicht ergriffen hat, darüber sagt es nichts. Und noch weniger, ob er es gesollt hätte. Noch darüber, welche Möglichkeiten er heute und morgen hat und haben wird, und was er daraus machen soll.
Ich sage nicht, dass jenseits der wissenschaftlichen kritischen Philosophie jedes praktische Urteil in concreto ästhetisch motiviert ist. Ich sage nur, dass das “poietische Vermögen” – also dasjenige, das den Menschen zum Qualifizieren befähigt – selber ästhetischer Qualität ist. Erstens glaube ich, dass dem historisch so ist , und zweitens meine ich, dass dem von Rechts wegen so sein soll.
Insofern meine ich “das Ästhetische” überhaupt nicht psychologisch , sondern ‘transzendental’: “Das ästhetische Vermögen ist die Fähigkeit, Qualitäten wahr-, d. h. wertzunehmen. Die Urteilskraft ist das Vermögen, Erscheinungen auf Qualitäten zu beziehen.”
Das Politische ist nicht selbst ‘ästhetisch’
In jedes einzelne, ‘historische’, empirische Urteil praktischer Natur – das heißt: jede poltische Entscheidung – fließen in concreto stets eine Unmenge konkreter ‘idiotischer’ Daten ein, die ‘auf Qualitäten bezogen’ sein wollen; aber das muss eben immer
Die Politik selber als praktische Disziplin kann nicht theoretisch oder gar wissenschaftlich sein.
Wissenschaftlich kann die Kritik sein. Nicht die Kritik an dieser oder jener konkreten Entscheidung , sondern an dem ‘Modell’, auf das sie sich (u. U.) bezieht. Die mehr oder weniger theoretischen Modelle, auf die politische Akteure ihr Handeln beziehen mögen, können selber nur in einem idiographischen Sinn ‘wissenschaftlich’ sein. Das heißt beschreibend und empirisch verallgemeinernd, nicht aber nomothetisch-’gesetzgebend’. Die Situation, wo man in ein theoretisches Modell (der Gesellschaft) nur noch die empirischen Daten einzutragen bräuchte, um heraus zu lesen, was zu tun ist, wird… niemals eintreten.
An dieser Stelle wird unweigerlich – sei es höhnisch, sei es nostalgisch – an die Marx’sche Theorie von der Weltrevolution erinnert.
“Historischer Materialismus”
Da trafen zwei theoretische Perspektiven zusammen. Zuerst die kritische: Die Kritik der politischen Ökonomie hatte zum Ergebnis, dass das theoretische Modell des ‘Wertgesetzes’ wissenschaftlich nicht haltbar war, weil der vorgeblichen Regel des Äquivalententauschs ein ungleicher Tausch zwischen Kapital und Arbeit zu Grunde liegt. Damit wurde die Rechtfertigung der kapitalistischen Gesellschaftsform durch das ‘Klassische Modell’ der Politischen Ökonomie, das sie zu einem ‘System’ metaphysiziert, hinfällig. Ein eignes positives Modell vom Funktionieren der bürgerlichen Gesellschaft findet man bei Marx nicht. Er hatte es ursprünglich im Sinn; aber da ahnte er noch nicht, dass seine beabsichtigte Vollendung der Politischen Ökonomie in deren Kritik umschlagen würde; das hat er erst gemerkt, als er das (fälschlich so genannte) ‘Formen-Kapitel’ der (fälschlich so genannten) ‘Grundrisse’ niederschrieb.
Der andere theoretische Strang ist die “materialistische Geschichtsauffassung”. Auch die ist ursprünglich kritisch. Sie richtet sich nämlich gegen die hergebrachte Auffassung, dass in der Menschheitsgeschichte Gesetze wirksam wären, die ihr von außerhalb auferlegt wären: von übersinnlicher Instanz. Ihre eigne ‘Voraussetzung’ ist lediglich, dass sie diese Voraussetzung zurückweist. ‘Materialistisch’ bedeutet schlicht und einfach nicht-spiritualistisch. Ihr selber liegt allein das empirische Prinzip ‘zu Grunde’, dass die Menschen ihre Geschichte selber machen. Ab da tut sie das, was Geschichtsschreibung zu tun hat: Sie beschreibt. Dafür ist wiederum besagtes ‘Formen’-Kapitel das beste Beispiel. In der literarischen Darstellung muss diese wie jede andere Beschreibungen schematisieren, die Fakten bestimmten Handlungsfäden zuordnen; wobei sie erklärtermaßen nicht ‘Alles’ beschreibt, sondern ihr Augenmerk auf die Herausbildung und dem Verhältnis der Gesellschaftsklassen richtet.
Die Epigonen – nicht erst Stalins Hofschranzen, sondern schon früher Dogmatiker wie Karl Kautsky – haben dann die ‘Handlungsfäden’ zu historischen Gesetzen entmaterialisiert. Und so ein kritische und revolutionäre Theorie in ihr staatserhaltendens Gegenteil verkehrt: Stalins terroristisch-totalitäre Monstrum brauchte eine Offenbarungslehre, durch die es als letztes Wort “des Gesetzes” imponieren konnte; “Vorsehung”, echote Stalins Spiegelbild im Führerbunker.
Modelle
Wenn aber die wisschenschaftliche Beschäftigung mit der Politik ohnehin nie dahin kommt, Gesetze aufzustellen – wozu taugen dann noch ihre theoretischen Modelle?
Ein Modell ist kein Gesetzbuch. Ein Gesetzbuch ist dafür da, den Fall einer Regel zu sumbsumieren. Das ist der Zeck der Naturwissenschaft. Das Modell ist Abbild eines idion. Es ist nicht die naturgetreue Nachbildung von ‘allem, was dazu gehört’, sondern ein Schema; ein Sinnbild, das wiedergibt, worauf es andem Idion dem Modellbauer angekommen ist; worauf er es abgesehenhat.
Zum Modellbauen gehört erstens die ‘Eingrenzung’ des Idion, und zweitens seine ‘Struktur’. Das bedeutet nichts anderes als Extensio und Intensio des Begriffs. Der Begriff hat – nämlich als Problem, wenn es ihm auch anders vorgekommen sein mag – dem Modellbauer ‘vorgeschwebt’. Die Sistierung, Fixierung des Vorschwebenden ist eben: die Ausührung des Modells. Das Modell ist die De-Finitio des Begriffs.
Hier wird klar: Das Idion ist kein Singulare; kein Einzelding, sondern eine Ganze Gestalt. Von einem Einzelding gibt es keinen Begriff, de singularibus non est scientia, da braucht man kein Modell. Einen Begriff braucht man für ein Mannigfaltiges, das von anderm Mannigfaltigen unterschieden werden soll. Er ist die Sinnbehauptung eines inneren Zusammenhangs; einer ‘Struktur’, wenn man diesen Ausdruck mag. Er ist keine Formel, in die man das konkrete Datum einträgt, um ein Ergebnis heraus zu rechnen, sondern eine Form, die man an eine lebendige Gestalt heranträgt, um zu sehen, ob sie passt.
Begriff ist Absicht, und die ist praktisch.
Der Begriff ist ein Sinnträger. Wer ihn verwendet, muss vorher wissen, wozu. Im Begriff ist ein Absehen ‘gemerkt’. Die Verwendung des Begriffs ist die Aktualisierung dieser Absicht. Wer ihn verwendet, muss wissen, dass er kein Gesetz anwendet, sondern einer Absicht folgt.
Kritik – die Wissenschaft – ist dazu da, ihn jedes Mal daran zu erinnern, wenn der “dialektische Schein” ihm schon wieder Mal eine metaphysische Substanz vorgaukeln will.
Absichten sind qualitativ. Das Vermögen, Erscheinungen auf Qualitäten, Tatsachen auf Absichten zu beziehen, ist die Urteilskraft. Das Vermögen, Qualitäten wahr-, d. h. wertzunehmen, heißt das ästhetische.
Die Philosophie fragt nicht danach, wie Menschen wirklich denken. Viele denken so, aber einige denken ganz anders. Im tatsächlichen Denken spielen Zufälle und äußere Verursachungen eine Rolle, Motive und Hindernisse. Wie und warum – das interessiert den Psychologen. Den interessieren aber nicht die Ergebnisse des Denkens, nämlich ob sie ‘zutreffen’ oder nicht. Ihn interessiert allenfalls, ob und warum der Denkende gelegentlich ganz etwas anderes tut, als er beabsichtigt hat: Dafür will der eine ‘Gründe’, der andre ‘Motive’ herausfinden…
Angenommen, es ließe sich mit allerletzter Sicherheit herausfinden, was im Bereich der Psychologie wahr ist – so wäre doch immer noch das, was in unserer Psyche vorgeht, Ergebnis eines Millionen Jahre alten faktischen Entwicklungsprozesses. Und von dem müsste man im Grundsatz annehmen, dass er möglicherweise an diesem oder dem andern Punkt auch anders hätte verlaufen können. In diesem Sinne handelt es sich um ein “Naturgeschehen”. Und dieses ist immer bedingt.
Sollten also die Hirnforscher demnächst herausfinden, dass der Satz “zwei mal zwei ist vier” durch die Evolution irgendwo in unseren grauen Zellen genetisch einprogrammiert ist, dann wäre das lediglich eine Anpassung an gegebene Umstände gewesen, die einen Selektionsvorteil begründet hat. Durch diesen wäre sie bedingt. Doch dass 2×2 wirklich =4 ist, wäre damit absolut nicht bewiesen! Dazu bedürfte es immer noch einer eigenen logischen Operation.
Bedeutungen
Bei philosophischen Fragestellungen geht es nicht (mehr) um das Tatsächliche. Über das muss man sich, und sei es nur vorläufig, schon geeinigt haben. Bei philosophischen Fragen geht es vielmehr um Bedeutungen. Nicht um das Tatsächliche, sondern um das “Logische”, nämlich um Sinnbezüge und Geltungen. Das sind Bestimmungen, die außerhalb von räum- lichen und zeitlichen (und also zufälligen) Bedingungen liegen. Eine Tat hat einen “Sinn” auch noch tausend Jahre, nachdem sie getan wurde, oder sie hat nie einen gehabt; und zwar unbedingt. Unbedingt im Übrigen auch dadurch, ob je einer diesen Sinn erkannt hat oder nicht. Und eine Aussage “gilt” auch dann, wenn die Gegenstände, über die sie ausgesagt wurden, längst nicht mehr existieren; und wenn kein Lebender sie je ausgesprochen hat!
Der Philosoph dagegen fragt, wie das – jedes! – Denken verfahren muss, wenn es wahr sein soll, und damit es wahr sein kann. Wahrheit ist Zweck seines Fragens, und in Hinblick auf diesen Zweck verfährt er ‘pragmatisch’. Ihn interessiert nur, was diesen Zweck fördert, und nicht das, was ihn stört. Zu beachten: Was immer dieser oder der Philosoph jeweils lehren mag – dass Wahrheit ’sein soll’, setzt er stillschweigend voraus, indem er Aussagen macht, die beanspruchen, als wahr zu gelten!
Der Satz “Es gibt keine wahren Sätze” (einige Denker neigen dieser Auffassung zu) widerspricht durch seine kategoriale (Urteils-) Form seinem (materialen) Gehalt. Es ist ein ähnlicher Fall wie das berühmte (Schein-) Paradox “Alle Kreter lügen”. Kommunikationstheoretisch ausgedrückt: Die Meta-Rede hebt die Objekt-Rede auf. Dieser Satz ist Sinn-widrig. Und nicht nur wird die Möglichkeit wahrer Sätze stillschweigend vorausgesetzt, sondern damit zugleich auch die Fähigkeit, ‘aus Freiheit’ äußere Verursachungen und innere Versuchungen aus meinem Denken auszuscheiden. Einem jeden steht es natürlich frei, diese Voraussetzungen zu bestreiten. Nur muss er sich dann aus der Erörterung von Aussagen, die wahr sein wollen, heraushalten.
Das Urteil und sein Grund
Mit der ‘Wahrheit’ ist es dasselbe Problem wie mit der ‘Freiheit’. Der Satz ‘der Mensch ist frei’ – bis heut ein Dauerbrenner der abendländischen Geistesgeschichte – ist theoretisch schlechterdings nicht beweisbar und also nicht diskutabel. Er lässt sich nur in der Form ‘der Mensch soll frei werden’ oder ‘du sollst handeln, als ob du frei wärst’ moralisch postulieren. Dennoch ist er mehr als bloße Meinung. Denn sein Gegen-Satz ‘Der Mensch ist unfrei’ lässt sich ohne inneren Widerspruch nicht formulieren.
Wer
ihn ausspricht, hat ein Urteil gefällt. Er hat nicht nur vorausgesetzt,
dass ‘es’ Gründe ‘gibt’ für sein Urteil (unabhängig von seiner
Subjektität), sondern er hat sich selbst auch das Vermögen
zugeschrieben, über deren Gültigkeit zu entscheiden. Das Vermögen, aus
eigenem Rechtsgrund zu urteilen, ist, als ‘liberum arbitrium’, das
Vermögen der Freiheit. Die kategoriale (Urteils-) Form des Satzes ‘der
Mensch ist unfrei’ hebt den materialen Gehalt des Satzes wieder auf.
Die Frage, ob wohl unser Wissen einen hinreichenden Grund hat – und daher ‘wahr’ ist -, lässt sich theoretisch, also im Rückgriff auf einen höheren (oder ‚tieferen’) Urteilsgrund nicht entscheiden – sonst wäre der jeweils aufgefundene Grund seinerseits begründet, und wir wären so klug wie vorher. Theoretisch stehen wir vor einem gordischen Knoten, der nicht gelöst, sondern nur zerschlagen werden kann: Unser Wissen muss einen Grund haben – weil anders all unsere Sätze ohne Sinn wären.
Hier wie oben wäre die entgegen gesetzte Annahme absurd: Keiner von uns könnte sie sinnvoll aussprechen, er müsste lallen oder den Mund halten. Wenn es im Leben einen Sinn geben soll, dann muss das Wissen einen Grund haben. Wer meint, das Leben bräuchte keinen Sinn, der kann nicht widerlegt werden. Er müsste sich allerdings aus der Erörterung sinnvoller Fragen heraushalten. Denn wer das Nichts behauptet, behauptet nichts, sagt Heidegger.
Die Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt, ist Unfug. Die Antwort darauf wäre, wie immer sie ausfiele, wahr oder unwahr. So kann man nur fragen, weil man sich von der Wahrheit längst eine Idee gemacht – und also die Antwort “in Wahrheit” schon vorausgesetzt hat.
Wahrheit ist kein vorhandener Stoff, den die empirischen Wissenschaften mit den geeigneten Instrumenten bei genügend schlauer Versuchsanordnung schon noch nachweisen werden, sondern ein Postulat. Sie “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor”. (vgl. Die philosophische Wendeltreppe XV)
Reflexiv
Die ‘Anpassung’ unserer Gehirnfunktionen durch Jahrmillionen von natürlicher Auslese geschah nicht um dieser Idee, sondern um des Überlebens willen. Es ist eine empirische, eine historische Tatsache – es ist eine ‘phänomenale Gegebenheit’, dass jene Gruppe von Vermögen, die wir zusammen fassend Vernunft nennen, uns durch die Evolution angestammt wurden. Woher sie auf uns gekommen sind, ist das eine. Das andre ist: Jetzt sind sie da. Und jetzt wenden wir sie auf alles an, was uns begegnet; auch auf unser Herkommen – und sogar auf sie selbst. Die Vernunft ist – das ist das ungelöste Mysterium der Hirnforschung – an und für sich reflexiv. Sie kann selbst ‘hinter sich zurück’ gehen, und darum ist sie selber unhintergehbar.
________________________________________________________________
Fünfte Windung: „Erziehungswissenschaft“ oder: Die Standesideologie der pädagogischen Zunft

Der Weg eines Wissensfachs von der Aporetik, die zwanglos von einem Problem zum andern fortgeht, so wie sie es sich (praktisch) stellen, zur Wissenschaft ist in den idiographischen Disziplinen nichts anderes als die Ausarbeitung des theoretischen Modells, in dem das Idion logisch schematisiert ist. Es ist die Bestimmung eines Begriffs – seinem Umfang (extensio) und seinem Inhalt (intensio) nach.
Gibt es von „Erziehung“ einen Begriff? Kann es eine Erziehungswissenschaft geben?
Der Begriff wäre die Antwort auf die Frage: Wer tut da was mit wem? Das ist das Idion. Wer mit wem, das wäre der Umfang; was, das wäre der Inhalt. Das Wie wäre gegebenenfalls Gegenstand des historischen Berichts, und wenn überhaupt, dann ließen sich aus ihm verallgemeinernde Sätze ableiten, die zwar ‚Gesetzlichkeit’ nicht für sich in Anspruch nehmen, aber doch einen pragmatischen Hinweis geben könnten, was man versuchen kann und was man besser unterlässt. Doch dies ist klar: Ohne Wer-was-mit-wem kann nach Wie gar nicht erst gefragt werden. Nicht nur auch, sondern gerade als historisches Fach ist „Erziehungswissenschaft“ auf einen klaren und bestimmten Begriff angewiesen.
Ich mache es kurz: Die pp. Erziehungswissenschaft, d. h. ihre Königsdisziplin, die Allgemeine Pädagogik, kann einen solchen Begriff nicht geben.
„Erziehen = Von einem Menschen s1 auf einen Menschen s2 gerichtetes absichtsvolles und geplantes Zuführen von Impulsen mit dem Ziel, dass s2 diese Impulse als Reize oder Informationen so verarbeitet, dass s2 Verhaltensbereitschaften bewahrt oder erwirbt oder so verändert, das s2 (in einer festgelegten Zeit) Verhalten realisiert, das den Soll-Zuständen von s1 entspricht.“ Diese denkwürdige Definition, die uns Lutz Michael Alisch und Lutz Roessner in „Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis“* gegeben haben, trifft auf den Bananenverkäufer auf dem Wochenmarkt und auf den Schaffner in der Straßenbahn ebenso zu. Ist sie bloß ein Kuriosum? Nein, sie spricht die Hilflosigkeit der ganzen Branche aus.
Irgendwie hat es mit Erwachsenen und mit Kindern zu tun (und kommen Sie mir jetzt nicht mit ‚Erwachsenenpädagogik’, Sie bringen ja alles nur noch mehr durcheinander!). Ach, und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, da stellen wir sogleich fest, dass es den ‚Begriff’, genauer: das Wort ‚Erwachsener’ grad mal seit zweihundert Jahren gibt – man merkt es schon an der verlegenen grammatikalischen Form: ein substantiviertes Partizip Perfekt. Vorher gab es Männer und Frauen (und Mütter und Väter); aber ein soziales Corps, das einem andern sozialen Corps namens Kinder als dessen Oppositum auflauerte, das gab es nicht. Denn ein kint war noch im Mittelhochdeutschen zunächst ein Sohn oder eine Tochter, später konnte jeder Jüngere jedem Älteren gegenüber ein kint heißen. Nur einen bestimmten biologischen Entwicklungsstand – das bedeutet ‚Kind’ erst in der bürgerlichen Gesellschaft.
Tatsächlich entsteht der Sozialstatus ‚Kind’ erst in eben dem Maße, wie die Angehörigen der sich ausbildenden bürgerlichen Gesellschaft zu ‚autonomen Subjekten’ (in der Philosophie), zu ‚Warenproduzenten’ (in der Nationalökonomie) und zu ‚Berufsmenschen’ (in der Soziologie) erwachsen. Seither erst kommen auch die Vokabeln ‚Erziehung’ und ‚Pädagogik’ in Gebrauch. Die Marktwirtschaft sorgt für einen so hohen Grad gesellschaftlicher Arbeitsteilung, dass an ein stilles, stetiges Hineinwachsen wie in den Handwerksstuben und den Bauernhöfen des Ancien Régime nicht mehr zu denken war. Seither bedarf es einer besonderen Schutz-, Dressur- und Zubereitungsphase, um zu einem vollgültigen Glied der Berufswelt gemacht zu werden. Von Pädagogen, von wem denn sonst?
Darum ist Pädagogik ein „Fach“, und darum braucht es eine „Erziehungswissenschaft“. Seine Extensio – das sind die Versorgungsansprüche der Pädagogen. Ihre Intensio sind die Wörter, die sie gebrauchen, um diesen Umstand zu verschleiern. Vorangegangen ist auf diesem Wege Friedrich Daniel Schleiermacher, den sie darum mit Grund als ihren Stiftungsvater erkennt.
Historisch war es zwar Johann Friedrich Herbart, der sie eine halbe Generation zuvor mit seiner Allgemeinen Pädagogik als akademisches Fach begründet hat. Aber er war ein erklärter Gegner der Schule. Und zwar nicht zuletzt aus diesem Grunde: weil sie auf die Dauer einen Berufsstand züchtet, dessen Eigeninteresse sich an die Stelle der pädagogischen Zwecke zu drängen neigt – zumal, wenn es „in öffentlichem Dienst“ auftreten darf. Kein Wunder, dass man ihm einen Schleiermacher vorzieht.
Der allererste Schritt beim Verschleiern ist, den pädagogischen Berufsstand aus dem Blickfeld verschwinden
 und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“
und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“Da „die jüngere Generation“ hier nur als Objekt in Frage kommt, die nichts zu „wollen“ hat, mag ihm dieser Ausdruck hier durchgehen. Wenn aber die „ältere Generation“ etwas will, dann… muss sie ein Subjekt sein. Das ist sie offenkundig nicht, wie sollte sie? Der Ausdruck ist eine bloße Mystifikation, unter der sich ein materielles Interesse tarnt. Die Pädagogenschaft „will“ stellvertretend für alle andern.
Man hätte wohl meinen können, mit der ‚älteren Generation’ seien hier die Eltern von Kindern gemeint. Aber deren „erziehende Tätigkeit verteilt sich ihnen unter ihr ganzes übriges Leben und tritt nicht gesondert hervor.“ Davon gibt es daher keine Wissenschaft. „Man bezieht also die Erziehungslehre auf diejenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen“ – verschämt ausgedrückt; man bezieht es also auf die Erwerbspädagogen.
Wie kommen die aber zu ihrer Stellvertreterrolle, was rechtfertigt sie? Plötzlicher Anflug christlicher Demut: „Ich sehe keinen andern Rat, als an dieser Stelle unserer Untersuchung abzubrechen und zu sagen, wir müssen an die jetzt bestehende Form der Erziehung unsere Theorie anschließen.“ Und das ist die Quintessenz des Ganzen! Zum Trost breitet er uns einen Weihrauchschleier drüber: Es nennt ‚das Ganze’ „Praxis“, und damit ist es glücklich aller Kritik entzogen; der wissenschaftlichen zumal.
Wissenschaft ist öffentliches Wissen. Sie ist entstanden, um in der Öffentlichkeit ein Feld abzustecken, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten, die immer auch von Interessen geprägt sind, vernünftiger Weise nicht mehr möglich sind. Dies ist ihr historischer Sinn.
Das Aufkommen der Wissenschaften im Abendland des siebzehnten, achtzehnten Jahrhunderts war das politische Weltergeignis schlechthin. Herrschaft konnte von nun an gemessen werden an dem, was ‘als vernünftig erkannt’ war. Und nur so ist eine repräsentative, nämlich die Staatsbürger repräsentierende politische Ordnung überhaupt denkbar.
Die Öffentlichkeit erwartet allerdings von der Wissenschaft, dass sie Gesetzestafeln erstellt, in die man die ‘konkreten Fälle’ nur noch einzutragen braucht, um die ‘richtige Lösung’ sogleich ablesen zu können. Es liegt daher im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Wissenschaft selbst, ihre Grenzen möglichst scharf zu ziehen.
Nirgends ist das dringlicher als bei der Erziehung der heranwachsenden Generationen. Schon wegen unserer Zukunft, nicht wahr? Aber auch, weil der Steuerzahler sein Geld nicht gern vergeudet.. Doch die Öffentlichkeit glaubt nur zu gern, dass die Erziehungswissenschaft ihr Gesetzestafeln zeigt, aus denen abzulesen ist, „was zu tun sei“. Doch eben das kann sie nicht bieten. Sie ist keine ‚nomothetische’ Disziplin, die Naturgesetze freilegt, die auf die „Praxis“ nur noch anzuwenden wären. Die ein jeder, unabhängig von Stand und Geburt, aber unabhängig auch von persönlichem Vermögen, nur zu lernen bräuchte, um sie zu beherrschen. Gesetze, die eine berufliche Zunft als Ganze rechtfertigen könnten und den Einzelnen seiner Verantwortung enthöbe…
Und so hätte es gern auch die Erwebserzieherschaft. Ihre Vorlieben sind Techniken, Methoden und Strukturen, über nichts reden sie lieber. Dass zum Pädagogen nur taugt, wer dazu taugt, kommt unter den Teppich. Störend ist das Wuchern der sogenannten Erziehungswissenschaften nicht an sich selbst – das wäre nur ein akademisches (und vielleicht fiskalisches) Problem. Störend, nein: katastrophal ist, dass die Fiktion einer Wissenschaft, die „die Praxis begründet“, den Beruf des Erziehers radikal entwertet, indem sie seine personale Verantwortung an ein Drittes delegiert – eine anonyme Instanz, einen Wörterberg, den man dreht und wendet wie man will, weil er sich nicht wehren kann. Doch was er zu tun und zu lassen hat, muss der Erzieher selber wissen
Nicht „zu viel Wissenschaft“ gibt es bei uns im Erziehungsgetriebe. Davon kann es gar nicht zu viel geben, wenn man es so versteht, wie es in einem idiographischen Fach nur zu verstehen ist: als Kritik. Sondern es gibt zu viel Pseudowissenschaft, und umso mehr Kritik ist nötig: an dem „dialektischen Schein“, dass aus dem bloßen Kombinieren von Begriffen sachliche Erkenntnis möglich würde. Newtons nil in verbis! gehört über unsere Schulportale geschrieben.
Die empirische Sozialforschung kann – in Längs- und in Querschnitten – herausfinden, welche Institutionen in der Geschichte ursächlich irgendwie mit der Verbreitung einzelner kultureller Kompetenzen in einem Gemeinwesen zusammenhängen. Aber die Summe dieser Kompetenzen insgesamt begrifflich unter „Erziehung“ zu fassen, ist genau so ein definitorischer Gewaltakt wie „Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst“. Darauf können sich Forscher in heuristischer Absicht einstweilen verständigen. Aber ansonsten ist es rein nominal und Schall und Rauch.
Eine solche historisch vergleichende Wissenschaft „vom Erziehen“ könnte, wenn sie eben mehr sein wollte als ein Zweig der Humanethologie, nur die Meinungen sammeln, die andere Leute über ein X geäußert haben, das sie „Erziehung“ nannten – und sie logisch-kritisch aufbereiten. Darüber hinaus kann sie in literarischer Sprache erzählen, was dieselben Leute – soweit man es sehen kann – dabei getan haben. In einer irgend exakten Weise beobachten kann sie es aber nicht, denn eben dazu bräuchte sie Begriffe, die sie nicht hat noch haben kann. Und in ganz besonders farbigen Worten kann sie uns ausmalen, was dabei „herausgekommen“ zu sein scheint – im Guten wie im Bösen. Das ist wörtlich gemeint: Es ist am Ende eine Frage von gut und böse. Das taugt nicht für Wissenschaft, sondern für den Roman.
In nüchterne Worte gebracht, zerfiele diese Forschungsrichtung in 1) Doxologie, und 2) historische Institutionssoziologie. Aber wie die beiden zusammenhängen – folgt die Meinung aus den Institutionen oder folgen die Institutionen aus den Meinungen; oder was heißt hier „Wechselwirkung“? – das bleibt immer Sache eines hermeneutischen Kunststücks. Und so allein gehört Wissenschaft in die pädagogischen Ausbildungspläne – historisch und kritisch.
Denn was er tun soll, muss ein Erzieher eben selber wissen. Er ist ein darstellender Künstler, der es immer drauf ankommen lassen muss.
*) München 1981, S. 38
“Die
Moral sagt schlechthin nichts bestimmtes. Sie ist das Gewissen, eine
bloße Richterin ohne Gesetz. Sie gebietet unmittelbar, aber immer
einzeln. Gesetze sind der Moral durchaus entgegen”…
 …notierte Novalis, als er Fichte
gelesen hatte. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man
Sittlichkeit nicht lernen kann wie irgend ein Pensum. Kann aber darum
keiner was für den andern tun? Muss jeder wieder ganz allein aufbrechen
und sehen, wo er bleibe? Nachdem so viel geschehen ist in der Geschichte
und sich schon so viele vor uns an den Rätseln der Welt versucht haben?
Dann hätten sie uns all ihre Zeugnisse ja ganz umsonst nachgelassen!
Nein, definieren lässt sich das Rätsel vom Sinn allerdings nicht. Aber es lässt sich zeigen.
…notierte Novalis, als er Fichte
gelesen hatte. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man
Sittlichkeit nicht lernen kann wie irgend ein Pensum. Kann aber darum
keiner was für den andern tun? Muss jeder wieder ganz allein aufbrechen
und sehen, wo er bleibe? Nachdem so viel geschehen ist in der Geschichte
und sich schon so viele vor uns an den Rätseln der Welt versucht haben?
Dann hätten sie uns all ihre Zeugnisse ja ganz umsonst nachgelassen!
Nein, definieren lässt sich das Rätsel vom Sinn allerdings nicht. Aber es lässt sich zeigen.Unter den hinterlassenen Reichtümern der vergangenen Generationen ist kaum einer, der ganz allein dem Stoffwechsel diente und der Erhaltung des Leben so, wie es war. Fast jeder Gegenstand, jedes Werk weist in seiner Gestaltung einen kleinen Überschuss – Entwurf, disegno, design - auf, der nicht nötig gewesen wäre zu seinem bloß sachlichen Nutzen. Dieses Mehr betrachten wir als seine ästhetische Seite. Sie war immer auch eine Art Stellungnahme zur Frage nach dem Sinn der Welt, mal mehr, mal weniger absichtlich. Und je mehr sein Schöpfer jeweils selber meinte, in seinem Werk die Frage beantwortet zu haben, umso sicherer erkennen wir Kunst darin, und die ist uns noch rätselhafter als die Natur, weil sie sich selbst für eine Lösung hält.
Seit der Romantik nun, als die Kunst modern
wurde, bescheidet sie sich, nein: macht sie sich’s zur Ehre, das Rätsel
nur noch darzustellen. Sie begibt sich ausdrücklich in Gegensatz zu
Industrie und Wissenschaft, die beide versprechen, spätestens morgen zu
klären, was heute noch im Dunkeln liegt. Industrie und Wissenschaft
behalten Recht, denn das Leben geht weiter. Doch je besser sie uns das
Leben und die Welt erklären, um so deutlicher wird auch, dass deren Sinn nicht in ihnen liegt, sondern außerhalb, als das immer neue Problem.
Als solches lässt es sich nicht begreifen und erlernen, sondern nur anschauen. Sein Medium ist nicht Logik, sondern Ästhetik. Das ist ein Erleben, wo nicht das Urteil erst – nach Analyse und Kritik – auf die Wahrnehmung folgt, sondern „auf einmal“ mit ihr selbst gegeben ist, uno actu. Nicht dass es aller Kritik entzogen wäre. Es ist nicht diskursiv, aber darum ist es noch lange nicht irrational; doch erst einmal muss es da sein, und das muss jeder selbst vollbringen – andemonstrieren lässt es sich nicht.
Als solches lässt es sich nicht begreifen und erlernen, sondern nur anschauen. Sein Medium ist nicht Logik, sondern Ästhetik. Das ist ein Erleben, wo nicht das Urteil erst – nach Analyse und Kritik – auf die Wahrnehmung folgt, sondern „auf einmal“ mit ihr selbst gegeben ist, uno actu. Nicht dass es aller Kritik entzogen wäre. Es ist nicht diskursiv, aber darum ist es noch lange nicht irrational; doch erst einmal muss es da sein, und das muss jeder selbst vollbringen – andemonstrieren lässt es sich nicht.
Das unterscheidet Bildung von Lernen. Güter lassen sich wägen und messen, aber Werte muss man erlebt haben. Auf Unterrichtseinheiten kann man es nicht verteilen, und methodischer Fleiß würde nur stören, denn er verengt das Wahrnehmungsfeld. Darstellbar ist es nicht als Argument und Kalkül, sondern in Bildern und Geschichten. Es erschließt sich nicht durch Analyse, sondern durch Betrachtung. Als die Hingabe an das Unbestimmte steht sie dem Spiel näher als der Arbeit. Sie ist der „ästhetische Zustand“.
Merke:
“Ethik und Aesthetik sind Eins.”
Ludwig Wittgenstein
Tractatus logico-philosophicus, Satz 6.421
“Ethik und Aesthetik sind Eins.”
Ludwig Wittgenstein
Tractatus logico-philosophicus, Satz 6.421
_________________________________________________________________________
Nüchtern betrachtet, ist erziehen eine Alltagsverrichtung wie kochen oder Auto fahren. Im Prinzip kann das jeder, aber manch einer besser als manch anderer. Wohl kann man aus diesem eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden.
Eine Alltagskunst
Eine Alltagskunst
Bei aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht. Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
Wann ‚erziehen’ Eltern? Die Frage taugt als Vorlage für ein Schmunzelbuch. Zweifellos doch, wenn sie belohnen oder strafen: denn das tun sie ja wohl vorsätzlich. Was lernen ihre Kinder dabei? Nutzen und Schaden abwägen. Das würden sie aber auch ohne dies lernen – vielleicht langsamer, vielleicht schneller. Gerade dafür ist Erziehen also nicht ‚notwendig’.
Tatsächlich geschieht das, was ein unbeteiligter Betrachter Belohnung oder Strafe nennt, im täglichen familiären Kuddelmuddel nicht vorsätzlich, sondern nebenher, ohne Kalkül. Das ist die Regel, die von Ausnahmen bestätigt wird – welche ihrerseits nur deshalb wirken, weil sie Ausnahmen sind. Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig, unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A und B an C zu schaffen machen.
Die pädagogische Situation
Einen allgemeinen Begriff von Pädagogik – oder einen Begriff von Allgemeiner Pädagogik – kann es nicht geben. Was es gibt, ist ein allgemeines Bild von der pädagogischen Situation. Nämlich: Einer, der in der Welt schon zuhause ist, begegnet einem, der dort neu ist, und ist er ein anständiger Kerl, dann zeigt er sie ihm. Darin liegt keinerlei Notwendigkeit, die in Begriffen, Gesetzen oder Formeln darstellbar wäre. Es ist nur eben tatsächlich so. Die Menschen neigen dazu – weil der Neue in diesem Bild typischerweise ein Kind ist.
Wer mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen. Wie gut er sich aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bisschen neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben ‚meiner’ Welt scheint.
Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom pädagogischem Eros umschrieben wurde. Im Alltag gelingt es umso eher, je näher Menschen einander stehen. Darum sind Eltern in der Regel die besseren Pädagogen. Normalisieren können sie nicht so gut, aber was ihrer Welt an schulischer Breite fehlt, überbieten sie an anschaulicher Tiefe. Sie sind Alltagskünstler (wenn auch vielleicht nicht alle.)
Performing artist
Man kann immer noch einen Beruf daraus machen. Aber weil Normalität kein berechtigter Erziehungszweck mehr ist, ist das Labor nicht mehr der bevorzugte Ort. Erziehung findet in Situationen statt, und die sind immer konkret. Erziehen ist eine Sache des Alltags. Pädagogik ist, wo sie theoretisch ist, Kunstlehre. Und der – gute – Erzieher ist ein Künstler.
Aber ein Aktionskünstler: er schafft keine ‚Werke’, sondern eben nur – Situationen. Seine Sache ist es, die Situationen so zu arrangieren, dass sie den andern verlocken, (sich) heraus zu finden; nie vergessend, dass er selber mitspielt und dass vieles auch auf seinen Auftritt ankommt. Was es ist und wieviel es ist, wird er wissen, wenn er es probiert. Er ist kein Ingenieur, sondern ein Performer.
______________________________________________________________
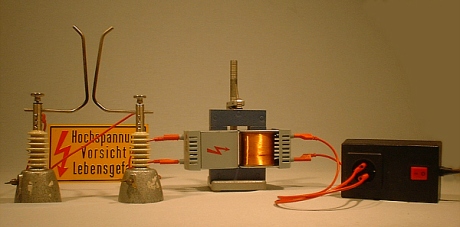
Die
Gemeinsamkeit der Philosophie mit den Geisteswissenschaften – oder
sagen wir besser: mit den idiographischen Disziplinen – ist eine
negative und rein technologische: Die idiographischen Fächer
müssen an die Stelle des in den Naturwissenschaften die Wahrheit
verbürgenden Experiments den Denk- versuch setzen, weil ihr Material
sich nicht in die Versuchsanordnungen der Labors fügt.
Das Material der Philosophie kommt anderswo als im Gedankenspiel gar nicht erst vor.
Das Material der Philosophie kommt anderswo als im Gedankenspiel gar nicht erst vor.
Andererseits ist die Philosophie aber auch eine Gesetzeswissenschaft, wenn auch eine problematische: Sie stellt fest, welche Regeln schlechterdings gelten – sofern überhaupt Etwas gelten soll.
Bedingt unbedingt.
Neunte Windung: Wissenschaft ist öffentliches Wissen, II.

Frage
ich einen Wissenschaftler, wodurch Wissenschaft sich von andern Arten
des Wissens unterscheidet, wird er mir sagen: Wissenschaft ist
begründetes Wissen. Wenn ich ihn dann frage, was das bedeutet, fangen
die Probleme überhaupt erst an… Es wird sich finden, dass er „im Grunde“
der Überzeugung ist, nichtwissenschaftliches Wissen sei „eigentlich“
überhaupt kein Wissen (sondern bloßes “Meinen“)… Dann wird er
Wissenschaft immanent zu erklären versuchen, anhand ihrer Verfahren, und
es läuft darauf hinaus: Wissenschaft ist „wahres“ Wissen, anderes
Fürwahrhalten ist kindisch…
Also Wissenschaft habe im Vergleich zu andern Arten des Wissens eine quasi onto-logisch höhere Qualität. Aber Wissen ist doch gar kein Sein, sondern ein Verhältnis zwischen (zwei oder mehreren) Seienden! Was könnte das aber heißen: ein „wahreres Verhältnis“?! Unterscheiden lässt sich nur ein Privatverhältnis von einem allgemeinen Verhältnis und ein notwendiges Verhältnis von einem zufälligen Verhältnis. Und so ist das Spezifikum der Wissenschaft auch schon erschöpfend umschrieben: Es ist Wissen, das allgemein und notwendig ist, im Unterschied zu Wissen, das privat und zufällig ist – wenn auch „das Gewusste“ in beiden Modis zufällig ganz und gar dasselbe wäre.
Also Wissenschaft habe im Vergleich zu andern Arten des Wissens eine quasi onto-logisch höhere Qualität. Aber Wissen ist doch gar kein Sein, sondern ein Verhältnis zwischen (zwei oder mehreren) Seienden! Was könnte das aber heißen: ein „wahreres Verhältnis“?! Unterscheiden lässt sich nur ein Privatverhältnis von einem allgemeinen Verhältnis und ein notwendiges Verhältnis von einem zufälligen Verhältnis. Und so ist das Spezifikum der Wissenschaft auch schon erschöpfend umschrieben: Es ist Wissen, das allgemein und notwendig ist, im Unterschied zu Wissen, das privat und zufällig ist – wenn auch „das Gewusste“ in beiden Modis zufällig ganz und gar dasselbe wäre.
Allgemein und notwendig: ist das eine additive Definition? Oder eine explikative (analytische: ‚zwei Seiten einer Medaille’)?!
Eben so: Nur ein Wissen, das sich als notwendig erweist, taugt dazu, allgemein zu werden. Dieser Prozess: ‚sich als notwendig erweisen’, heißt Reflexion/Kritik. Es ist die Verallgemeinerung dieses Prozesses, durch den Notwendigkeit sich erweist. Summa summarum: Wissenschaft ist öffentliches Wissen; im Unterschied zu privatem. Die Form ist in diesem Fall die Sache selbst. Oder: der historische Unterschied ist zugleich der logische.
Civil society essentially is public space. But public opinion, by its nature, is divided. Science is able to reduce that domain of dissent; it is public knowledge. Its apogee in modern times was the political event par excellence. Its coercive power resides in its systematic proceeding from assuring its logical foundation, to the conceptual seizure of its object.

Kant
hat bemerkt, wie ohne Zweifel viele vor ihm, dass die hundert Taler,
die er sich denkt, doch leider ganz was andres wären, als hundert Taler,
die er in seiner Tasche trüge. Wohl wahr, sagt Hegel; aber so ganz und
gar nichts wäre das, was man sich denkt, andrerseits doch auch wieder
nicht.
Die Taler in der Tasche und die Taler in der Vorstellung haben eins gemein: Alle zweihundert haben eine Bedeutung. Will sagen, in beiden Modi können sie mich dazu bestimmen, mich so oder anders zu verhalten. Ob ich sie habe, sie nicht zu haben bedaure, sie zu haben begehre, sie zu haben nicht achte…
Die Taler in der Tasche und die Taler in der Vorstellung haben eins gemein: Alle zweihundert haben eine Bedeutung. Will sagen, in beiden Modi können sie mich dazu bestimmen, mich so oder anders zu verhalten. Ob ich sie habe, sie nicht zu haben bedaure, sie zu haben begehre, sie zu haben nicht achte…
Licht in dieses Mysterium hat Hermann Lotze gebracht. Er unterscheidet – Ei des Kolumbus – drei verschiedene Wirklichkeits- oder besser Gegebenheitsmodi: das (allbekannte) Sein, das (später so genannte) Erleben und das – erst von ihm zur Geltung gebrachte – Gelten. Von den so genannten Wahrheiten sagt er insbesondere: “Sie schweben nicht zwischen, außer oder über dem Seienden. Als Zusammen- hangsformen mannigfaltiger Zustände sind sie vorhanden nur in dem Denken eines Denkenden, indem es denkt, oder in dem Wirken eines Seienden in dem Augenblick seines Wirkens.” (Lotze, Mikrokosmos, III/2, 579)
Das war erst nur eine logisch formale Unterscheidung. Materi- allogisch gedacht, müsste es so heißen: Allererst ‚gegeben’ ist das Erleben selbst; ein Strom von Empfindungen, in dem Sinnliches, Logisches und ästhetisch-moralisch Werthaftes noch gänzlich ungeschieden als ein und dasselbe „in Erscheinung treten“.
Alles, was danach kommt, ist ein Arbeitsprodukt der Reflexion.
Die hundert Taler in meiner Vorstellung und die hundert Taler in meiner Tasche gelten gleich, wenn ich an ihnen eine Rechung – sagen wir: von Zins und Zinseszins – durchführe. Sie gelten ganz verschieden, wenn ich eine Schneiderrechnung bezahlen soll.
Mit ihrem Sein hat das durchaus zu tun – indem es nämlich in mein Dasein mal mehr, mal weniger eng verstrickt ist.

Wir nehmen keine Erscheinungen wahr. Wir nehmen keine Bedeutungen wahr. Wir nehmen Dieses oder Das wahr. Was ist Dies oder Das? Eine Erscheinung, die etwas bedeutet. Könnte sie mir nichts bedeuten, würde sie mir nicht erscheinen.
Die Unterscheidung geschieht nicht in der Anschauung, sondern in der Reflexion. Wahrnehmung ist das Produkt beider. Die Reflexion rechnet auf eine Bedeutung. Wenn sie keine erkennen kann, fragt sie; sogar, wenn sie döst. Reflexion ist Absicht.
In seiner Wirklichkeit ist unser Wahrnehmen kein linearer Ablauf in Stufenfolge – erst anschauen, dann reflektieren, dann wahrnehmen in specie; oder andersrum. Sondern, wie die zeitgenössische Hirnforschung nahelegt, ein systemischer Prozess “in Permanenz”. Es wird nicht erst diese, dann jene und schließlich eine dritte Hirnregion aktiv, sondern sie interagieren “apriori”; und sie warten regelrecht darauf, zu tun zu kriegen, sie suchen sich ihren Stoff. Darum spielt es auch keine Rolle, welche der jeweils beteiligten Regionen stammesgeschichtlich die ältere und welche die jüngere ist. Heute agieren sie allezeit uno actu als Ein Ganzes System.
So geschieht das Bewerten des unmittelbar durch die Sinnes- reize Gegebenen – was man das ‚ästhetische Erleben’ nennen könnte – gleichzeitig in mehreren Hirnarealen, insbesondere dem Limbischen System, das aus mehreren entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teilen besteht, und der als Gustatorischer Cortex bezeichneten ‚Inselrinde’, die in der entwicklungsgeschichtlich viel jüngeren Fissura Lateralis liegt. Und zugleich spielen in noch immer unverstandener Weise die Reaktionen des Plexus solaris hinein, der überhaupt nicht zum Zentralen System gehört, sondern aus einem Nervenknoten in der Bauchhöhle besteht – und insofern „uralt“ ist.
Wenn also Baumgarten seinerzeit das ästhetische Erleben als das „niedere“ Erkenntnisvermögen bezeichnet hat, war das in neurophysiologischer Hinsicht grundfalsch. Es spielt in die „höheren“ Erkenntnisvorgänge jederzeit hinein, so wie jene in diese.
Aber in philosophischer Hinsicht ist es diskutabel. Die Philosophie betrachtet das Wissen – als Inbegriff all unseres Gewärtigseins – nicht in seinem physiologischen oder psychologischen Vorkommen, sondern nach seinem logischen Aufbau. Logisch kommt von logos, und bezeichnet alles auf Sinn und Vernünftigkeit Bezogene (und nicht lediglich die Regeln des korrekten Schlussfolgerns). Zwar ist auch in logischer Hinsicht das Wissen (wenn es da ist) jederzeit ‚ganz und auf einmal’ da. Aber zugleich ist es ‚geworden’.
Allein in logischer Hinsicht folgt notwendig eines aus dem andern, nur in logischer Hinsicht gibt es ‚Begründung’ (und in der Naturwissenschaft wird die Vorstellung der Kausalität nur ‚sozusagen’ verwendet, zu heuristischen Zwecken). In logischer Hinsicht ‚gibt es’ also zuerst und danach. Da müssen die Sinnesreize zuerst ‚da’ sein, bevor sie ‚gemerkt’, und gemerkt werden, bevor die ‚gewertet’ werden können. Die logisch-genetische Betrachtung ist etwas anderes als die historisch-empirische.
Allerdings ist in logischer Hinsicht die Begründungskette umkehrbar (was sie in der Naturwissenschaft, wo Begründung nur ‚sozusagen’ vorkommt, nicht ist). Wenn das eine notwendig das andere zur Folge hat, dann hat das andere notwendig das eine als Grund. Mit andern Worten, der Schluss ‚begründet’ in logischer Hinsicht den Anfang ebenso, wie jener ihn. Stellen wir uns das Wissen als einen unbegrenzten Prozess vor – was es genetisch sicher ebenso ist wie historisch -, dann ist das wirkliche Wissen eine endlose Umbegründung alles wechselseitig Begründeten.
Das Gewärtigsein ist, wenn alles klappt, eine Revolution in Permanenz.
Dass alles klappt, ist in Ansehung unserer engen bürgerlichen Verhältnisse selten. Das ist schlecht für die Verhältnisse.
____________________________________________________
Zwölfte Windung: “Ich weiß”

Das allgemeine Ergebnis der Kritischen Philosophie lässt sich in diesem Satz zusammenfassen: Es gibt kein Wissen ohne Prämissen. In unserem wirklichen tagtäglichen Normalwissen gibt es tausendundeine Annahme über Tatsächliches. Diese lassen sich (prinzipiell) auf wissenschaftlichem (experimentellem + logisch spekulativen) Weg überprüfen. Ziehe ich alle diese faktologischen Wissenspartikel von meinem Wissen ab, so bleibt als Substrat immer noch übrig der Elementargestus „ich weiß“.
Ich weiß – das heißt, ich nehme an einem (mir irgendwie gegebenen) X irgend (-wie irgend-) einen Anteil. Sei es, dass es (zum Teil) Teil von mir, sei es, dass ich (zum Teil) Teil von ihm werde: Beides ist nicht zu unterscheiden; denn beides ist gleichermaßen (‚nur’) “im Wissen“.
Nahe liegt es, die Entstehung meines Wissens als einen Akt des Ergreifens aufzufassen. Aber das ist nur eine Metapher. Es könnte ebenso gut sein, dass sich das außer mir Seiende von außen meinem Wissen einprägt wie auf eine Tabula rasa. Das eine ist die idealistische, das andere die realistische Auffassung vom Weg der Erkenntnis. Beide gehen von verschiedenen Prämissen aus, beide können einander darum gegenseitig nicht am Zeug flicken, denn beide haben keinen gemeinsamen Grund, vor den sie ihre Argumente als deren Richter tragen könnten.
Wenn beide nur zwar einander nicht widerlegen können, heißt das dennoch nicht, dass einer so gut gelten könnte wie der andere. Denn der realistische Standpunkt – der mit den Eindrücken auf der Tabula rasa – kommt nie an den Punkt, wo er uns zeigen kann: Sieh her, hier wird aus dem einprägenden Akt des Gegenstandes ein Anblick von dem Gegenstand. Geschweige denn ein Anblick von dem Anblick! Die realistische Auffassung kann uns nicht nur nicht erklären, wie es zu einem Wissen von etwas – und mithin zu einem Wissen von Etwas – kommen kann, sondern schon gar nicht, wie es möglich ist, dass wir von diesem Wissen wissen.
 Wenn das Wissen
bloß ein Rezeptakel wäre, wo die Vernunft lediglich ‚vernimmt’ (wie J.
Fr. Herbart wortspielerte), wäre die Tatsache der Reflexion nie
und nimmer zu verstehen. Die Reflexion ist aber der springende Punkt
des Wissens, denn erst in ihr trennen sich Bild und Gegenstand und
Gegenstand und Subjekt von einander. Ohne sie gäbe es nur ein dumpfes Da!, wie es womöglich Tieren vorkommt – und selbst das wäre vielleicht schon zuviel gesagt.
Wenn das Wissen
bloß ein Rezeptakel wäre, wo die Vernunft lediglich ‚vernimmt’ (wie J.
Fr. Herbart wortspielerte), wäre die Tatsache der Reflexion nie
und nimmer zu verstehen. Die Reflexion ist aber der springende Punkt
des Wissens, denn erst in ihr trennen sich Bild und Gegenstand und
Gegenstand und Subjekt von einander. Ohne sie gäbe es nur ein dumpfes Da!, wie es womöglich Tieren vorkommt – und selbst das wäre vielleicht schon zuviel gesagt.Die idealistische Auffassung des Wissensakts hat diese Sorge nicht. Und keineswegs hat sie es nötig, die Wirklichkeit der Dinge der Außenwelt irgend in Zweifel zu ziehen; denn das wäre eine metaphysische Frage, die ganz außerhalb ihres Gesichtskreises liegt. Das Wissen ist ein aktives Anteilnehmen, ein Zugreifen meiner auf das, was mir in Raum und Zeit begegnet. Dass es ist, lag vor meinem Zugreifen (darf ich annehmen, wenn ich es auch nicht wissen kann), aber wie und was es ist, „ereignet“ sich erst im Zugriff, nicht davor und nicht danach.
Man muss sich von der Vorstellung freimachen, dass in unserem Wissen die Sachen selbst vorkämen – Dinge, Tatachen, Sachverhalte, Zustände. In umserem Wissen sind immer nur die Bilder vorhanden, die wir uns von den Sachen – Dingen, Tatsachen, Sachverhalten, Zuständen – gemacht haben. Wir können uns immer nur darüber streiten, wessen Bilder schärfer, deutlicher oder für die Mitteilung brauchbarer sind – was sich immer erst im Vollzug entscheidet. Nicht können wir uns darüber streiten, wessen Bilder wahrer, authentischer, den Sachen adäquater sind – weil wir dafür keinen übergeordneten Maßstab haben; so wenig, dass wir nicht einmal angeben können, was mit solchen Formulierungen gemeint ist.
Mit anderen Worten, was “ich weiß”, muss sich immer erst noch bewähren – an den Sachen, wie sie im Meinungsverkehr vorkommen.
Wahr wäre also, was im tatsächlichen Verkehr einstweilen als wahr gilt – jusqu’à nouvel ordre? Gibt es also immer nur bedingte Wahrheit?
Na ja. Auch eine bedingte Wahrheit gilt nur insofern für wahr, als immerhin ihre Bedingung gilt. Tja, und so weiter… Ob nun fünf, fünftausend oder fünf Billionen über das Gelten dieser einen bestimmten Wahrheit sich einstweilen verständigt haben möchten – sie mussten doch immer (“irgendwie”) voraussetzen, dass irgend Etwas den empirisch, faktisch (“historisch”, sagt Fichte) bedingten Geltungen ungedingt zu Grunde liegt. Der Satz ‘alle Wahrheit ist relativ’ ist ein Unsatz. Entweder Wahrheit ist oder ist nicht.
Dass Wahrheit sei, ist die unvorgreifliche Prämisse allen Wissens.
________________________________________________________________
Dreizehnte Windung: Geist und Materie, oder: Natur und Geschichte

Ich kann das Gewicht einer Kartoffel nicht erfahren, wenn ich ein Metermaß anlege, und ihren Umfang nicht mit der Waage messen. Ich kann das eine nicht aus dem andern ableiten noch das eine ins andere umrechnen. Es sind zwei verschiedene Dimensionen, die aber nicht in der Kartoffel stecken – die ist immer ein und dieselbe -; sondern in der Eigenart meines Wahrnehmungsapparats.
Genau so sind Freiheit und Kausalität einander irreduzibel.
*
Die Kartoffel in diesem Bild ist der Mensch.
Wenn ich mich einmal entscheide, eine Sache durch die Augen der Naturwissenschaften anzuschauen, habe ich ipso facto mitentschieden, sie unters Gesetz der Kausalität zu fassen: beides ist dasselbe. Habe ich einen Gegenstand mit den Augen, das heißt den Messinstrumenten der Naturwissenschaften angeschaut, kann es nicht ausbleiben, dass ich ihn als einen Gegenstand der Naturwissenschaft erkenne. Jenes folgt aus diesem, und nicht umgekehrt.
Die Knolle Mensch muss ich aber nicht als einen Gegenstand der Naturwissenschaft anschauen. Ich kann sie – nur sie – auch als den Gegenstand der Geschichtsschreibung ansehen: als ein Wesen, das Geschichte hat, weil es sie macht. Andernfalls würde es die Frage nach dem freien Willen gar nicht geben. Stammt sie etwa aus der Naturwissenschaft? Da kommt sie nicht her, da gehört sie nicht hin.
Nur wer sagt, der Mensch ist in seinen Willensentscheidungen frei, kann auch sagen, dass er in der Welt etwas tun soll. Ist alles determiniert, dann haben die Recht, die schon immer gesagt haben, man kann nix machen. Gemeint war jedes Mal: Ich brauch’ nix machen. Bevor Freiheit und Determination ein Problem der Geschichtswissenschaft werden können, sind sie eine politische Frage.
Freilich ist dieses Problem längst gelöst. Die endgültige Antwort heißt: Die Menschen machen ihre Geschichte selber, aber sie machen sie nicht unter frei gewählten Bedingungen; und stammt von Karl Marx. Die nicht frei wählbaren Bedingungen sind für der Geschichtsschreibung das, was für die Naturwissenschaft die determinierenden Faktoren sind. Für eine ‚verstehende’ Geschichtswissenschaft (wie Max Weber sie nennt) treten die Bedingungen des Handelns in den Motiven der Handelnden wieder auf: als deren Triebkraft. Aber nicht als deren Richtung. Die muss der freie Wille, politischer Verstand oder Unverstand, ex sponte hinzufügen.
*
Mögen die Psychologen die Triebkraft der Motive zur Natur rechnen: Der Philosoph wird den Willen immer zum Geist zählen (was auch sonst?).
_____________________________________________
Vierzehnte Windung: Die Naturgeschichte des Kausalitätsprinzips.

Der Entschluss, Naturwissenschaft zu betreiben, und der Entschluss, alles, was erscheint, als Einzelfall eines Gesetzes anzusehen, sind ein und dasselbe. Denn durch diesen Entschluss Galileo Galileis wurden die Naturwissenschaften begründet.
Die Grundform des Naturgesetzes ist das Kausalprinzip. Es bedeutet, alles, was ist, als ein Ereignis aufzufassen, das mit Notwendigkeit aus einem vorangegangenen Ereignis folgt. Dieses Prinzip ist nicht aus der Forschung gewonnen, sondern liegt ihm zu Grunde. Es ist eine heuristische, „regulative“ Annahme, durch die Forschung erst möglich wird. Dass sie sich im Verlauf der Forschung bewährt, macht den Erfolg der Forschung überhaupt erst aus: Die Natur der Wissenschaft ist definiert als das Reich, wo Kausalität herrscht. Es ist eine Petitio principii. Wenn etwa die Hirnphysiologie findet, dass ein freier Wille nicht statt hat, holt sie aus ihrer Forschung nur heraus, was sie vorab hineingetan hat.
Solange sie es dabei bewenden lässt, ist alles in Ordnung. Wenn sie aber aus einem regulativen Prinzip ein konstitutives Prinzip macht, betreibt sie Metaphysik und verlässt den Boden der Naturwissenschaft.
Das Kausalprinzip ist kein Fund der Wissenschaft, sondern ein Selektionsprodukt der Lebenswelt. Es beruht auf der im Laufe einer millionenjährigen Gattungsgeschichte angehäuften Erfahrung, dass ich, wenn ich einen noch nicht vorhandenen Zustand wünsche, zu dem vorhandenen Zustand etwas hinzufügen muss, nämlich einen Akt. Ich muss wirken.
Die Urform des Kausalprinzips ist der Animismus. Nämlich die Annahme, dass alle Dinge, die mir begegnen, so sind (und selbst, dass sie sind), weil sie es wollen. Sie wirken, weil sie so wirken wollen. Eine Unterscheidung zwischen ‚zufälligen’ und ‚notwendigen’ Ereignissen ist noch gar nicht möglich, denn zu jedem unerwarteten Ereignis kann ein noch unbekanntes beseeltes Subjekt hinzugedacht werden.
Doch die Erfahrung lehrt, dass viele Ereignisse sich vorhersehen lassen, und einige eben nicht. Der Mythos löst diesen Widerpruch, indem er an die Stelle der ganz individuellen immer allgemeinere Subjekte setzt. Gottheiten und Dämonen sorgen für Regelmäßigkeiten, von denen sie willkürlich abweichen können. Nicht mehr die Dinge selber wirken, sondern werden bewirkt. Und so der Mensch.
Die Form des Mythos ist die (positive) Erzählung, nicht die (fragende) Untersuchung. Man muss ihn glauben, fürs Wissen ist er ungeeignet. Die Fragen fernzuhalten ist sein eigentlicher Zweck. Die mythische Epoche ging unter mit dem Aufkommen der griechischen Philosophie. Ist das, was erscheint, so wie es ist, oder ist es in Wahrheit etwas anderes? Es beginnt das Zweifeln.
Es gibt nichts als Schein, meint Heraklit von Ephesos, und Parmenides von Elea entgegnet: Nur was erscheint, ist Schein; das Wahre ist nicht sichtbar, sondern nur dem Denken zugänglich. Ist oder ist nicht; Werden ist Täuschung. Der eine verneinte die Notwendigkeit, der Andere den Zufall. Hier griff Platos Ideen-Lehre ein. Die Ideen lagen nunmehr jeweils einer ganzen Klasse von Ereignissen zugrunde, sie waren ‚vor’ den Göttern auf dem Olymp. Sie waren das eigentlich Sein. Das Werden, das wir auf der Erde beobachten, ist uneigentlich, es ist das Wirken des Wahren in der Erscheinung. Zufall ist nur Schein, und doch die Erscheinungsweise des Notwendigen. Wissen – im Unterscheid zu bloßem Meinen – ist: im Zufälligen das Notwendige ergründen.
Aristoteles’ Gedanke der Entelechien, deren jede ihr Entwicklungsgesetz ganz allein in sich trägt, war demgegenüber ein Rückgriff auf animistische Vorstellungen. Er behinderte die Ausbildung einer systematischen Forschung so lange, bis Galileo Platos Ideenlehre umformte in die Lehre von allgemeinen Naturgesetzen. Seither ist eine Kausalbetrachtung möglich und experimentell bewährte Wissenschaft.
Ein Gesetz muss gesetzt worden sein. Die Vorstellung von einem Schöpfergott wird nötig – ein unbegründeter Grund, causa sui, ein unbewegter Beweger. Kein Problem für die Theologie, aber unbefriedigend für den Forscher. Wenn Gott die Naturgesetze erlassen hat – ist er ihnen dann selber unterworfen? Dann wäre er nicht länger Gott. Er hätte am Anfang lediglich einen Fingerschnipp, une chiquenaude getan, um die Maschine in Bewegung zu setzen, dann setzte er sich zur Ruhe. So spöttelte Blaise Pascal über das ‚System’ des Descartes.[*]
Spinoza hat es radikal gelöst: Gott ist selber Naturgesetz, deus sive natura. Das ist im Wesentlichen Stand der Wissenschaft. Die Annahme, die Naturgesetze seien im Urknall erst entstandenen, macht lediglich den Urknall selbst zur causa sui. Alles bleibt im Rahmen des Gesetzes von Ursache und Wirkung, und auf dem Boden der Wissenschaft. Denn das Kausalprinzip reicht immer nur bis ganz dicht an den Urknall heran und nicht in ihn hinein und schon gar nicht hinter ihn zurück. Die Frage, was vor dem Urknall war, entzieht sich der Kausalbetrachtung und gehört nicht zur Naturwissenschaft. Man mag sie spekulativ und experimentell in mythischen Bildern behandeln, und sie dann nach ihrer Plausibilität bewerten. Aber positiv erforschen lässt sich da nichts.
Und jedem Wissenschaftler steht es frei, den Urknall selbst für den Sitz des Schöpfergottes zu halten – solange er das privat für sich tut und nicht die Öffentlichkeit damit behelligt.
*
Bleibt eines hinzu zu fügen. Niemand ist gehalten, die ganze Welt naturwissenschaftlich zu betrachten. Das tut auch der Naturwissenschaftler nicht, denn damit würde er nicht einen Tag im wirklichen Leben überstehen. Naturwissenschaftlich denkt er im Labor, nur da ist es am Platz.
[*] …das Malebranche daher um die Zutat ergänzte, dass Gott die Freiheit bleibt‚ ’bei Gelegenheit’ immer wieder mal steuernd einzugreifen – womit aller Wissenschaft der Garaus gemacht ist.


















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen