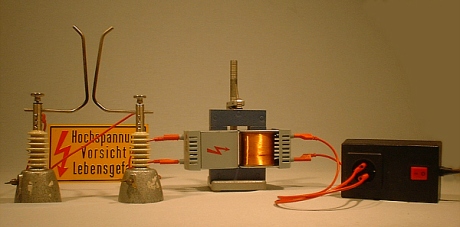Die Philosophie fragt nicht danach, wie Menschen wirklich denken. Viele denken so, aber einige denken ganz anders. Im tatsächlichen Denken spielen Zufälle und äußere Verursachungen eine Rolle, Motive und Hindernisse. Wie und warum – das interessiert den Psychologen. Den interessieren aber nicht die Ergebnisse des Denkens, nämlich ob sie 'zutreffen' oder nicht. Ihn interessiert allenfalls, ob und warum der Denkende gelegentlich ganz etwas anderes tut, als er beabsichtigt hat: Dafür will der eine 'Gründe', der andre 'Motive' herausfinden…
Angenommen, es ließe sich mit allerletzter Sicherheit herausfinden, was im Bereich der Psychologie wahr ist – so wäre doch immer noch das, was in unserer Psyche vorgeht, Ergebnis eines Millionen Jahre alten faktischen Entwicklungsprozesses. Und von dem müsste man im Grundsatz annehmen, dass er möglicherweise an diesem oder dem andern Punkt auch anders hätte verlaufen können. In diesem Sinne handelt es sich um ein “Naturgeschehen”. Und dieses ist immer bedingt.
Sollten also die Hirnforscher demnächst herausfinden, dass der Satz "zwei mal zwei ist vier" durch die Evolution irgendwo in unseren grauen Zellen genetisch einprogrammiert ist, dann wäre das lediglich eine Anpassung an gegebene Umstände gewesen, die einen Selektionsvorteil begründet hat. Durch diesen wäre sie bedingt. Doch dass 2×2 wirklich =4 ist, wäre damit absolut nicht bewiesen. Dazu bedürfte es immer noch einer eigenen logischen Operation.
Bei philosophischen Fragestellungen geht es nicht (mehr) um das Tatsächliche. Über das muss man sich, und sei es nur vorläufig, schon geeinigt haben. Bei philosophischen Fragen geht es vielmehr um Bedeutungen. Nicht um das Tatsächliche, sondern um das "Logische", nämlich um Sinnbezüge und Geltungen. Das sind Bestimmungen, die außerhalb von räumlichen und zeitlichen (und also zufälligen) Bedingungen liegen. Eine Tat hat einen "Sinn" auch noch tausend Jahre, nachdem sie getan wurde, oder sie hat nie einen gehabt; und zwar unbedingt. Unbedingt im Übrigen auch dadurch, ob je einer diesen Sinn erkannt hat oder nicht. Und eine Aussage "gilt" auch dann, wenn die Gegenstände, über die sie ausgesagt wurden, längst nicht mehr existieren; und wenn kein Lebender sie je ausgesprochen hat.
Der Philosoph dagegen fragt, wie das – jedes! – Denken verfahren muss, wenn es wahr sein soll, und damit es wahr sein kann. Wahrheit ist Zweck seines Fragens, und in Hinblick auf diesen Zweck verfährt er 'pragmatisch'. Ihn interessiert nur, was diesen Zweck fördert, und nicht das, was ihn stört. Zu beachten: Was immer dieser oder der Philosoph jeweils lehren mag – dass Wahrheit 'sein soll', setzt er stillschweigend voraus, indem er Aussagen macht, die beanspruchen, als wahr zu gelten.
Der Satz "Es gibt keine wahren Sätze" (einige Denker neigen dieser Auffassung zu) widerspricht durch seine kategoriale (Urteils-) Form seinem (materialen) Gehalt. Es ist ein ähnlicher Fall wie das berühmte (Schein-) Paradox "Alle Kreter lügen". Kommunikationstheoretisch ausgedrückt: Die Meta-Rede hebt die Objekt-Rede auf. Dieser Satz ist Sinn-widrig. Und nicht nur wird die Möglichkeit wahrer Sätze stillschweigend vorausgesetzt, sondern damit zugleich auch die Fähigkeit, 'aus Freiheit' äußere Verursachungen und innere Versuchungen aus meinem Denken auszuscheiden. Einem jeden steht es natürlich frei, diese Voraussetzungen zu bestreiten. Nur muss er sich dann aus der Erörterung von Aussagen, die wahr sein wollen, heraushalten.
Das Urteil und sein Grund
Mit der 'Wahrheit' ist es dasselbe Problem wie mit der 'Freiheit'. Der Satz 'der Mensch ist frei' – bis heut ein Dauerbrenner der abendländischen Geistesgeschichte – ist theoretisch schlechterdings nicht beweisbar und also nicht diskutabel. Er lässt sich nur in der Form 'der Mensch soll frei werden' oder 'du sollst handeln, als ob du frei wärst' moralisch postulieren. Dennoch ist er mehr als bloße Meinung. Denn sein Gegen-Satz 'Der Mensch ist unfrei' lässt sich ohne inneren Widerspruch nicht formulieren.
Wer ihn ausspricht, hat ein Urteil gefällt. Er hat nicht nur vorausgesetzt, dass 'es' Gründe 'gibt' für sein Urteil (unabhängig von seiner Subjektität), sondern er hat sich selbst auch das Vermögen zugeschrieben, über deren Gültigkeit zu entscheiden. Das Vermögen, aus eigenem Rechtsgrund zu urteilen, ist, als 'liberum arbitrium', das Vermögen der Freiheit. Die kategoriale (Urteils-) Form des Satzes 'der Mensch ist unfrei' hebt den materialen Gehalt des Satzes wieder auf.
Die Frage, ob wohl unser Wissen einen hinreichenden Grund hat – und daher 'wahr' ist –, lässt sich theoretisch, also im Rückgriff auf einen höheren (oder 'tieferen') Urteilsgrund nicht entscheiden – sonst wäre der jeweils aufgefundene Grund seinerseits begründet, und wir wären so klug wie vorher. Theoretisch stehen wir vor einem gordischen Knoten, der nicht gelöst, sondern nur zerschlagen werden kann: Unser Wissen muss einen Grund haben – weil anders all unsere Sätze ohne Sinn wären.
Hier wie oben wäre die entgegen gesetzte Annahme absurd: Keiner von uns könnte sie sinnvoll aussprechen, er müsste lallen oder den Mund halten. Wenn es im Leben einen Sinn geben soll, dann muss das Wissen einen Grund haben. Wer meint, das Leben bräuchte keinen Sinn, der kann nicht widerlegt werden. Er müsste sich allerdings aus der Erörterung sinnvoller Fragen heraushalten. Denn wer das Nichts behauptet, behauptet nichts, sagt Heidegger.
Die Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt, ist Unfug. Die Antwort darauf wäre, wie immer sie ausfiele, wahr oder unwahr. So kann man nur fragen, weil man sich von der Wahrheit längst eine Idee gemacht – und also die Antwort "in Wahrheit" schon vorausgesetzt hat.
Wahrheit ist kein vorhandener Stoff, den die empirischen Wissenschaften mit den geeigneten Instrumenten bei genügend schlauer Versuchsanordnung schon noch nachweisen werden, sondern ein Postulat. Sie "kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor". (vgl. Die philosophische Wendeltreppe XV)
Reflexiv
Die 'Anpassung' unserer Gehirnfunktionen durch Jahrmillionen von natürlicher Auslese geschah nicht um dieser Idee, sondern um des Überlebens willen. Es ist eine empirische, eine historische Tatsache – es ist eine 'phänomenale Gegebenheit', dass jene Gruppe von Vermögen, die wir zusammenfassend Vernunft nennen, uns durch die Evolution angestammt wurden. Woher sie auf uns gekommen sind, ist das eine. Das andre ist: Jetzt sind sie da. Und jetzt wenden wir sie auf alles an, was uns begegnet; auch auf unser Herkommen – und sogar auf sie selbst. Die Vernunft ist – das ist das ungelöste Mysterium der Hirnforschung – an und für sich reflexiv. Sie kann selbst 'hinter sich zurück' gehen, und darum ist sie selber unhintergehbar.
Nachtrag. - Wem alle es so machen, könnte das psychologische Gründen haben. Wenn's aber nicht anders geht, hat das logische Gründe.
15. 9. 15