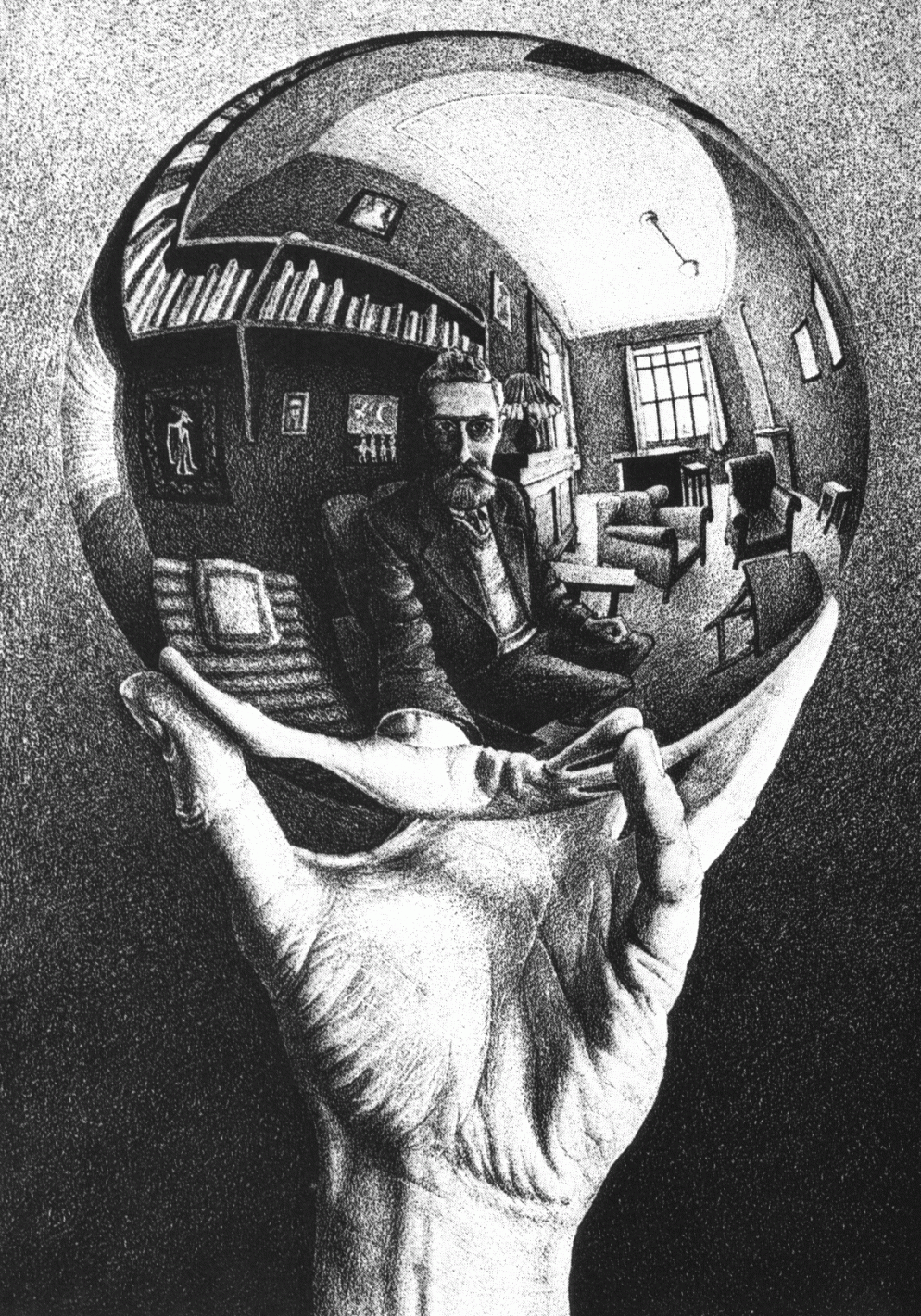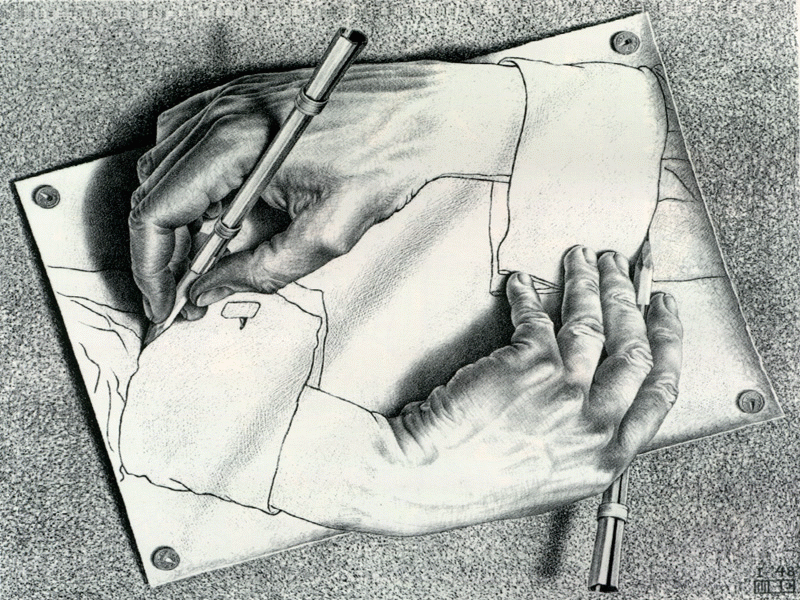Am Ende der Arbeitsgesellschaft
oder
Der Gebrauchswert der Intelligenz
Dass das Menschenleben von der Arbeit geprägt ist, ist kein
Naturzustand. Dass die Gesellschaft von der Wirtschaft beherrscht wird,
verdankt sie einem historischen Ereignis und keinem Gesetz.
Wirtschaften bedeutet: die Allokation knapper Ressourcen.
Diese primäre Definition beruht auf einer durchaus nicht selbstverständlichen
historischen Prämisse: daß die Ressourcen so knapp sind, dass ihre Verteilung
ein Problem darstellt. Und dabei
handelt es sich nicht um eine schlichte Tatsache, sondern um ein Verhältnis
zwischen zwei fraglichen Größen: der Vermehrbarkeit der Ressourcen einerseits
und der Menge der Bedürfnisse andererseits. Allokation der Ressourcen bedeutet
daher: die Entscheidung darüber, welche – und wessen – Bedürfnisse bei der
Verteilung mehr gelten sollen als
andere.
Aus dem Mangel…
Wären beide Größen – Umfang der Bedürfnisse, Umfang der
Ressourcen – gegeben, entstünde kein wirtschaftliches
Problem. Das Problem wäre rein politisch: Wer setzt sich durch? In einem
spezifischen Sinn wirtschaftlich wird das Problem nur dann, wenn die beiden
Variablen – Bedürfnisse/Ressourcen – durch ein Bedingungsverhältnis einander vermittelt sind; kein logisches, sondern
ein sachliches. Ein solches tritt ein in dem Moment, wo die Ressourcen durch Arbeit vermehrt werden können;
denn damit stellt sich die Frage: wer arbeitet wie viel? Denn es ist zugleich
die Frage: Legitimieren sich die individuellen, um die Ressourcen
konkurrierenden Bedürfnisse durch eigene Arbeit, oder aus anderen Quellen?
Wirtschaften ist keine Konstante des menschlichen
Gattungslebens. Es bildet die Rückseite der Fähigkeit des Menschen, durch
Arbeit mehr zu erzeugen, als er verbraucht. Wirtschaftsgesellschaft und Arbeitsgesellschaft
bedeuten dasselbe. Entstanden sind sie mit der Sedentarisierung und dem
Übergang zum Ackerbau.
In der Welt der Jäger und Sammler waren jahrmillionenlang
die Ressourcen nicht eo ipso knapp, und die Verteilung war kein Problem. War
die Gegend, die eine Menschengruppe bewohnte, abgeweidet, wanderte sie weiter.
Wurden die Zeichen beizeiten erkannt, trat Knappheit gar nicht ein. Andernfalls
blieb sie – wie der Überfluss - eine momentane Ausnahme, die nicht lange genug
währte, um die Formen des Zusammenlebens zu prägen. (Denn wird Knappheit zum Dauerzustand, stirbt
die Gruppe aus.) Unter solchen Umständen geschieht die Allokation naturwüchsig,
eine gesellschaftliche Formbestimmung bildet sich nicht aus.
Der Getreideanbau bringt einen qualitativen Wandel. Durch
Arbeit wird es möglich, einen stetigen Überschuss zu erzeugen. Ein beständiges
Bevölkerungswachstum tritt ein. Ursprünglich trat Knappheit momentan als Mangel
an einer bestimmten, absoluten Anzahl benötigter Dinge auf. Nun herrscht
ständiger Mangel durch das stetige Wachstum der Bedürfnisse. Ab hier reden wir
von Geschichte in einem bestimmten Sinn: "Diese Erzeugung neuer
Bedürfnisse ist die erste geschichtliche Tat." Welche
Bedürfnisse gelten sollen, wird nun
strittig.
Durch die Konkurrenz neuer Bedürfnisse auf der einen, mit
einer wachsenden Menschenmasse auf der andern Seite wird die Allokation
erstmals zum Problem, denn diese
Konkurrenz ist dauerhaft und prägt schließlich die Formen des Zusammenlebens.
Das Naturverhältnis wird überlagert von gesellschaftlichen Bestimmungen. Eine
Differenzierung beginnt in jene, die Anspruch auf die "höheren
Bedürfnisse" haben, und solche, die überzählig sind und denen im Notfall
auch die primären Bedürfnisse verweigert werden. Denn der Boden, an dem die
Arbeit ausgeführt wird, ist monopolisierbar. Der Arbeiter kann von ihm
abgetrennt werden.
Nicht aus dem Eigentum folgt die Differenzierung, sondern
aus tatsächlicher Differenzierung bildet sich das Eigentum.
Nicht Alle sind sesshaft geworden, nicht Alle betreiben
Ackerbau. Die Herrenvölker folgen weiterhin als Jäger den Wanderungen der
Tiere, bis sie zu ihren Hirten werden. Die Hirtenvölker scheuen die Arbeit,
aber nicht deren Früchte. Die Habe muß verteidigt werden. Die Herausbildung
einer Kriegerkaste reproduziert im Innern den Gegensatz zu den nomadisierenden
Herren im Äußern. Auch die inneren Herren arbeiten nicht. Sie zehren von der
Mehrarbeit der Andern. Die Aneignung geschieht politisch, nicht
'wirtschaftlich'. Vom Arbeitsprodukt greift sie schließlich auf das
Arbeitsmittel selbst über. (Dasselbe wiederholt sich mit der Ausbildung der
Grundherrschaft im frühmittelalterlichen Europa.)
Mit der wachsender Arbeitsproduktivität einerseits und der
Monopolisierung des Bodens andererseits wird eine relative Überbevölkerung zur
Geschichtskonstante, der Mangel für die Vielen und die Akkumulation von
Reichtum bei wenigen wird zum Dauerzustand, es beginnt der Klassenkampf, und
das Politische entwickelt sich zu einem autonomen Bereich des
gesellschaftlichen Lebens.
…erwächst die Wirtschaft.
Arbeit ist das allgemeine Mittel zur Behebung von Notdurft.
Sie ist das Nützliche-an-sich und Ressource-schlechthin. Eine Welt, die sich
negativ im Zeichen der Notdurft versteht, definiert sich positiv als Arbeitsgesellschaft. Ihre
vollendete, ‚ausgebildete’ Form ist die Marktwirtschaft: Alles hat seinen
Preis. Jetzt müssen die Arbeiten gegeneinander austauschbar, ihre jeweiligen
Qualitäten müssen mess- und vergleichbar sein. Die Nützlichkeit der einen Sache
muß sich in der Nützlichkeit der andern Sache darstellen lassen. An die Stelle
der Gebrauchswerte tritt der Tauschwert, der ‚Wert’ der Nationalökonomen:
wiederum eine Nützlichkeit-an-sich, also wiederum Arbeit - als die allgemeinste Ware.
Marktwirtschaft
bedeutet eo ipso Industriegesellschaft.
Dass regelmäßig nur gleiche Wertgrößen sich gegen einander austauschen, setzt
voraus, dass Arbeit regelmäßig als Lohnarbeit stattfindet - weil der Arbeiter
vom Boden getrennt ist und nicht mehr selber über die Mittel verfügt, die er
zur Realisierung seines Arbeitsvermögens braucht. Denn erst, wenn die Arbeit
ihrerseits als Ware gehandelt wird, kann sie sich im Austauschprozess als
dessen durchschnittlich gültiger Maßstab 'ausmitteln'. An ihm kann Alles
miteinander verglichen und gegeneinander getauscht werden. Die Bedürfnisse
behaupten sich als gültig durch das Maß, in dem sie über (eigenes oder fremdes)
Arbeitsvermögen verfügen. Durch die bestimmte Art der Produktion ist eine
bestimmte Weise der Aneignung eo ipso mit'gesetzt'. Seither verteilen die
Ressourcen 'sich selber', d. h. nach einer ökonomischen
Regel, auf die Bedürfnisse.
Diese Regel beruht auf der Doppelnatur der Arbeit. Sie ist
einerseits Verausgabung eines lebendigen Vermögens. Andererseits kann sie –
unter gegebenen sachlichen Voraussetzungen - mehr 'Werte' schaffen, als zu
dessen eigener Erzeugung und Erhaltung erforderlich waren. Wer über dieses
Vermögen verfügt, eignet sich den
Mehr-Wert an, nicht wer es (verausgabend) realisiert.
Dieses "Wertgesetz" ist keine den Sachen selber innewohnende Kraft
noch eine selbstherrliche Bewegung der Begriffe, sondern nur die gedankliche
Schematisierung eines wirklichen Geschehens unter gegebenen Bedingungen.
Die Bedingungen
waren, dass die Ressourcen schlechterdings knapp,
aber schlechterdings durch Arbeit
vermehrbar sind, und dass Arbeit die allgemeingültige Ware ist, weil Lohnarbeit
vorherrscht. Das wiederum setzt voraus, dass das Arbeitsvermögen regelmäßig von
den Mitteln seiner Realisierung getrennt ist.
Die Vermehrung der
Ressourcen beruht auf der wachsenden Produktivität der Arbeit; das heißt:
fortschreitender Arbeitsteilung und Kooperation. Zu einem prozessierenden
System wurden sie in der mechanisierten Fabrik der Großen Industrie
ausgebildet. Technologisch bedeuten sie die progressive Übertragung von
Leistungen des lebendigen Arbeiters auf das Arbeitsmittel. Im reellen
Fertigungsprozess kommt die Arbeit wesentlich als Durchschnittsgröße vor, Verausgabung
von standardisierter Kraft, technischem Geschick und nervlicher Ausdauer; wobei
die individuelle Intelligenz des lebendigen Arbeiters nur residual und als
Fehlerquelle auftritt. Es handelt sich um all das, was an der produktiven
Handlung wiederholbar ist. Ist es
wiederholbar, dann ist es mechanisierbar. All dies wird im Lauf der technischen
Entwicklung sukzessive in das Arbeitsmittel selbst eingebaut: in die Maschine.
Der
Gebrauchswert der Intelligenz
„In
dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des
wahren Reichtums abhängig weniger von dem Quantum angewandter Arbeit, als von
der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden
und die selbst wieder in keinem Verhältnis stehen zur unmittelbaren
Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom
allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie. Was
Tätigkeit des Arbeiters war, wird Tätigkeit der Maschine.“ So tritt der
Arbeiter „neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. Sobald
die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums
zu sein, hört [auf] und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und
daher der Tauschwert [Maß] des Gebrauchswerts.“ Mit andern Worten, das
Wertgesetz verfällt – so hat es Karl Marx in den Grundrissen vorhergesagt.
Seine Erfüllung
findet der Prozess der technologischen Arbeitsteilung inden computergesteuerten automatisierten
Werkstätten der Gegenwart. Hier ist nun auch ein Teil, nämlich der kombinatorische Anteil der lebendigen
Intelligenz als 'Programm' kodiert worden und auf die Maschinen selbst
übergegangen. Als Spezifikum der wirklichen lebendigen Arbeit, das
schlechterdings nicht digitalisiert und kybernetisiert werden kann, ist am Ende
des Prozesses der inventive, konzipierende
Anteil der Intelligenz übrig geblieben: das lebendige Einbildungs- und
Urteilsvermögen. Die Arbeitsteilung erreicht einen Punkt, wo sie die Qualität
der Arbeit verändert. Die 'Gebrauchswertseite' macht sich gegen die bloße
Formbestimmung (wieder) geltend. Das Individuelle gewinnt über den Durchschnitt
die Oberhand. Der Tauschwert verfällt.
Ressourcen,
die durch Arbeit vermehrt werden können, sind an sich nun nicht mehr knapp. Virtuell sind die Bedürfnisse
befriedigt, "produktionell" herrscht Überfluss. Wo Mangel aktuell
noch immer auftritt, ist er kein ökonomisches, sondern lediglich ein Verteilungsproblem, das "nur noch"
politisch gelöst werden muss. Und umgekehrt werden zusehends solche Ressourcen
knapp, die durch Arbeit nicht
vermehrt werden können und ipso facto keinen Tauschwert haben. Deren Verteilung
auf die Bedürfnisse ist von Anfang an keine ökonomische, sondern
"nur" eine politischen Aufgabe.
Arbeit bleibt übrig als schiere Intelligenz: Einbildungs- und
Urteilsvermögen. Deren Betätigung bezeichnen wir mit dem aktivischen Zeitwort wissen. Insofern ist die Feuilletonrede
vom "Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft" treffender
als ihre Kolporteure denken. Freilich, nicht die Datei – nicht die Daten und
schon gar nicht deren Gespeichertsein –
macht Wissen aus, sondern die Generierung von Wissbarem; denn die
Kombinatorik besorgt die Maschine. (Ein Bildungssystem, das das Arbeitsvermögen
zu einem Analogon der Datenverarbeitungs- maschine ausbilden will, die es soeben
verdrängt hat, ist der Nachhall des vergangenen Industriezeitalters und kein
Auftakt zur 'Wissensgesellschaft'.) Ein so auf seinen 'einfachsten Ausdruck'
zurückgeführtes Arbeitsvermögen ist nun nicht
mehr regelmäßig getrennt von den Bedingungen seiner Ausübung. Es reicht ein
Internetanschluss, mag man überspitzt sagen.
Intelligenz hat keinen Tauschwert
Aber Intelligenz hat keinen Tauschwert. Weil
einbilden und urteilen nur actu geschieht
und als solches nicht wiederholbar ist, wird er Philosoph sagen. Doch die
Erzeugnisse von Einbildung und Urteil kann man sehr wohl wiederholen, sogar
hersagen, ohne sie zu verstehen. Und gerade darum hat Intelligenz keinen
Tauschwert: "Das Produkt der geistigen Arbeit steht immer
tief unter ihrem Wert. Weil die Arbeitszeit, die nötig ist, um sie zu
reproduzieren, in gar keinem Verhältnis steht zu der Arbeitszeit, die zu ihrer
Originalproduktion erforderlich ist. Z.B. den binomischen Lehrsatz kann ein
Schuljunge in einer Stunde lernen" – sagt Marx.
Denn der Tauschwert ist keine sachliche
Eigenschaft des Produkts, sondern eine durch den gesellschaftlichen Verkehr ihm
zugerechnete Größe; nicht die Arbeit, die gestern zu seiner Herstellung
wirklich aufgewendet wurde, sondern die Arbeit, die heute notwendig wäre, um es
wieder herzustellen. Die Ausbildung –
oder sagen wir besser: die Bildung einer solchen Intelligenz mag viele lange
Jahre dauern und ein Vermögen kosten. Aber ihre Produktionen sind so gut wie
gar nichts 'wert', weil schon morgen sie die Spatzen von den Dächern pfeifen.
Wo soll da ein 'Mehr'-Wert herkommen? Selbst in seinem innersten Kern, dem
Doppelcharakter der Arbeit, hat sich so das Wertgesetz von selbst erledigt.
Wir wissen, welche Welt zu Ende geht. Wir
wissen nicht, welche Welt entsteht. Es nützt nichts, aus dem Kaffeesatz zu
lesen, welcher Parameter uns morgen 'Maß und Substanz' der Werte liefern kann,
wenn es denn die Arbeit nicht mehr tut. Man muss sich – vielleicht noch nicht
wir, aber die zwei, drei Generationen nach uns – auf eine Welt einstellen, in
der die Sachen nichts mehr 'wert' , oder wo nicht mehr die Sachen etwas 'wert'
sind. Das wäre keine andere Art des Wirtschaftens, sondern es wäre kein
Wirtschaften mehr. Kein Ermitteln von Durchschnittsgrößen in blinden,
selbstgesteuerten 'Prozessen ohne Subjekt', sondern Einbilden und Urteilen,
wann und wo sich's ergibt. Keine ökonomische, sondern eine politische
Gesellschaft.
Der dritte Große Sprung
Nach der Erfindung des aufrechten Gangs, nach
dem Einbruch der Arbeit in unser Gattungsleben wird dies unser dritter Großer
Sprung. Es ist allerdings das erste Mal, dass wir in vollem Bewusstsein
springen. Das gibt der Feuilletonvokabel Wissensgesellschaft
eine unerwartete Pointe.
______________
1) K.
Marx in: Die Deutsche Ideologie, Marx-Engels-Werke Bd. 3, Berlin (O) 1958, S.
28
Eine erweiterte Fassung dieses Aufsatzes finden Sie